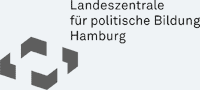Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Sonja Steinhart * 1923
Sandweg 42 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
HIER WOHNTE
SONJA STEINHART
JG. 1923
SEIT 1935 MEHRERE
HEILANSTALTEN
"VERLEGT" 23.9.1940
BRANDENBURG
ERMORDET 23.9.1940
"AKTION T4"
Sonja Steinhart, geb. am 20.7.1923 in Hamburg, ermordet am 23.9.1940 in der Tötungsanstalt Brandenburg an der Havel
Sandweg 42, (Eimsbüttel)
Sonja Steinhart wurde in Hamburg-Eimsbüttel als zweites Kind von Amalie, geborene Löwenthal, geboren am 13. Februar 1887 in Hamburg, und Nuta Steinhart, geboren am 10. Mai 1882 in Bendzin in Schlesien (heute Będzin in Polen), geboren.
Sonjas Vater ist in der Kultussteuerkartei der Hamburger Jüdischen Gemeinde als Nuta Sztainchart verzeichnet; die Familie galt also als polnisch. Von Polen aus, wo seine Eltern, Rikla, geborene Bilka, und Jakob Aaron Sztainhart in Soszowice lebten, war er im Jahre 1908 zunächst nach Hannover und nach der Heirat mit Sonjas Mutter am 28. März 1913 nach Hamburg gezogen. Er arbeitete als Uhrmacher.
Sonjas Vorfahren mütterlicherseits lassen sich über viele Generationen nachweisen. Der Großvater Hermann Löwenthal, bei dem Sonja aufwuchs, war in New York am 15. Juli 1857 zur Welt gekommen. Seine Mutter Pauline, geborene Hirsch, geboren in Hamburg, stammte von dem Geflügelhändler Heymann Salomon Hirsch und Betty, geborene Moses, geboren in Peine, ab. Sein Vater David Levy Löwenthal stammte aus Ovelgönne, Herzogtum Oldenburg, war Handelsmann und wohnte mit seiner Familie in der Hamburger Neustadt im Lazarus Gumpel Stift, Schlachterstraße 44. Hermann Löwenthal hatte sich als Uhrmacher und Juwelier in Hamburg zusammen mit seinem jüngeren Bruder Martin, geboren am 29. Mai 1860 in Hamburg, niedergelassen und am 22. November 1884 sein Gewerbe als Uhrmacher in der Elbstraße 22 angemeldet.
Beide entwickelten eine enge familiäre und sicher auch eine geschäftliche Verbindung zur Familie Abraham Freyd. Dieser war als Pfandleiher unter anderem im Gold- und Silberhandel tätig. Sonjas Urgroßvater Abraham Freyd, geboren 1841, stammte aus Lodsel, Russisch-Polen, seine Ehefrau Sarah, geborene Cohen, aus Posen. Die Familie hatte zeitweise in Glasgow in Schottland gelebt. Im Jahre 1870, im Alter von 14 Jahren, war Sonjas Großmutter Fanny Freyd mit ihren Eltern und ihren ebenfalls in Glasgow geborenen jüngeren Geschwistern, Rebecca, geboren 1863, Michael, geboren 1867, und Isaac, geboren 1869, nach Hamburg übergesiedelt.
Hermann Löwenthal heiratete Fanny Freyd am 12. März 1886 in Hamburg. Am 1. September 1887 ging sein Bruder mit Fannys Schwester Rebecca Freyd die Ehe ein. In beiden Ehen kamen Töchter zur Welt. Sonjas Mutter Amalie wurde in Hamburg noch im selben Jahr geboren, Martin und Rebecca Löwenthals Tochter Paula kam am 3. September 1895 in der Johnsallee 68, Hamburg-Eimsbüttel, auf die Welt.
Beide Brüder und somit auch ihre Familien wurden am 20. Oktober 1897 in den Hamburger Staatsverband aufgenommen. Einen Monat zuvor, im September 1897, waren Sonjas Urgroßvater Abraham Freyd und seine Familienangehörigen der Jüdischen Gemeinde Hamburg beigetreten. Abraham Freyd verstarb am 4. Juni 1902, ein Jahr, später, am 30. Juni 1903, starb auch seine Ehefrau Sarah Freyd. Sie wurden auf dem Jüdischen Friedhof Langenfelde bestattet. Zwei Jahre nach der Heirat von Sonjas Eltern in Hamburg am 28. März 1913 starb auch Sonjas Großmutter Fanny Löwenthal, geborene Freyd, am 11. Oktober 1915. Auch sie fand ihre letzte Ruhe auf dem Jüdischen Friedhof Langenfelde.
Am 26. Juni 1918 erweiterte Sonjas verwitweter Großvater Hermann Löwenthal sein Gewerbe und meldete sich als Händler mit Juwelen, Uhren, Gold- und Silberwaren, optischen Gegenständen, Antiquitäten und Kunstsachen in der Fruchtallee 109 an. Sonjas Vater Nuta arbeitete dort im kaufmännischen Bereich. Noch im selben Jahr, am 20. November 1918, wurde Sonjas fast fünf Jahre ältere Schwester in Hamburg geboren. Ihren Vornamen Fanny bekam sie nach ihrer verstorbenen Großmutter.
Etwa 1923 verlegte Sonjas Großvater Hermann Löwenthal sein Uhrmachergeschäft in die Weidenallee 8, Hs. C II.
Sonja wuchs bei ihren Eltern, ihrer Schwester und mit ihrem verwitweten Großvater Hermann Löwenthal im Sandweg 42 in Hamburg-Eimsbüttel auf.
Der Zeitpunkt von Sonjas Einschulung ist nicht bekannt, auch nicht der Name ihrer Schule.
Das Uhrengeschäft von Sonjas Großvater lief gut und wurde von vielen nichtjüdischen Kunden besucht. Mit dem Boykott der jüdischen Geschäfte durch die Nationalsozialisten am 1. April 1933 änderte sich dies. Nach und nach blieben viele Kunden fern, die wirtschaftliche Situation der Familie wurde schwieriger. Außerdem litt die Familie unter den zunehmenden Diskriminierungen.
Die Räume des großväterlichen Geschäfts in der Weidenallee, in dem Sonjas 16-jährige Schwester Fanny als Verkaufslehrling mitarbeitete, mussten aufgegeben und die Werkstatt in die Wohnung Sandweg verlegt werden. Die Familie war gezwungen, mit dem immer geringer werdenden Verdienst auszukommen, die Haushaltshilfe musste sie entlassen.
Zwei Monate vor ihrem zwölften Geburtstag, am 4. Mai 1935, wurde Sonja Steinhart in den damaligen Alsterdorfer Anstalten aufgenommen. Eine Krankenakte, die Hinweise auf Sonjas Gesundheitszustand und die Umstände ihrer Einlieferung geben könnte, ist nicht erhalten. Lediglich im Aufnahmebuch ist die Notiz "Schwachsinn mit Veitstanz" vermerkt. Veitstanz, medizinisch bezeichnet als Chorea, ist mit seinen charakteristischen Bewegungsstörungen ein Symptom mehrerer Krankheiten mit unterschiedlichen Ursachen, Krankheitsverläufen, therapeutischen Vorgehensweisen und Heilungschancen. Die diagnostischen Möglichkeiten waren zu jener Zeit eingeschränkt, eine genaue Bestimmung der Krankheit schwierig.
Die nächsten drei Jahre verbrachte Sonja Steinhart in den Alsterdorfer Anstalten. Ob sie erfuhr, was in ihrer Familie in dieser Zeit geschah, wissen wir nicht. 1936 lebte diese fast nur noch vom Erlös ihrer Wertgegenstände. Am 1. Januar 1937 musste Sonjas Großvater Hermann Löwenthal sein Geschäft schließen. Die Familie hatte ihre Existenzgrundlage verloren.
Nach Aufzeichnungen in der Kultussteuerkartei und Aussagen von Sonjas Schwester Fanny nach dem Krieg kehrte Sonjas Vater mit seiner Familie, die durch ihn die polnische Staatsbürgerschaft innehatte, am 27. November 1937 in seine Heimatstadt Bendzin in Polen zurück. Dort lebten sie von seinem geringen Verdienst als Vertreter eines Lotteriegeschäftes und von der Unterstützung durch Verwandte. Vermutlich um diese Zeit kam dort Sonjas Bruder Rudolf, genannt Reuven, zur Welt. Sonjas Schwester Fanny absolvierte eine Lehre als Friseuse und begann zu arbeiten.
Währenddessen war Sonja in Hamburg in den Alsterdorfer Anstalten zurückgeblieben. Auch ihr Großvater Hermann Löwenthal lebte weiter in Hamburg.
Mit der zunehmenden Ausgrenzung und Verfolgung der jüdischen Mitbürger fand auch die "Verlegung" der jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner aus den Alsterdorfer Anstalten statt. Im Zuge dessen wurde Sonja Steinhart am 12. April 1938 in die Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn überstellt.
In der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 1939 verstarb Sonjas Großvater Hermann Löwenthal, der inzwischen in der Rappstraße 10 ptr. bei Petrover wohnte. Auf dem Jüdischen Friedhof Langenfelde fand er neben seiner Ehefrau seine letzte Ruhe.
Sonjas Vater wurde während des Überfalls der Deutschen Wehrmacht auf Polen in Bendzin ermordet. Sonjas Schwester Fanny berichtete später, Gestapobeamte hätten ihn am 9. September 1939 aus dem Haus geholt und auf offener Straße erschossen.
Für Sonja und ihre jüdischen Mitpatientinnen und -patienten nahm die menschenverachtende Rassenpolitik der Nazis verbunden mit ihren "Euthanasie"- Plänen einen verhängnisvollen Verlauf. Als die Anordnung erging, jüdische Patientinnen und Patienten aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg zum 18. September 1940 in der Heil- und Pflegeanstalt Hamburg-Langenhorn zusammenzuziehen, befand sie sich schon vor Ort. Am 23. September 1940 ging ihr Transport nach Brandenburg an der Havel in die sogenannte Landes-Pflegeanstalt ab, wo die Ankömmlinge noch am selben Tag mit Kohlenmonoxyd getötet wurden. Zur Verschleierung dieser Mordaktion wurde in Sterbemitteilungen behauptet, dass die Betroffenen in einer Anstalt in Chełm (polnisch) oder Cholm (deutsch) östlich von Lublin verstorben seien.
Sonja Steinhart wurde nur 17 Jahre alt.
Auch ihre Familie wurde von den Nationalsozialisten fast vollständig ausgelöscht.
Die Mutter Amalie Steinhart wurde zusammen mit Sonjas kleinem Bruder Rudolf (Reuven) von Bendzin aus in ein Vernichtungslager deportiert und ermordet.
Paula Zeckel, geborene Löwenstein, Sonjas Großcousine, war mit ihrem Ehemann Abraham Zeckel in die Niederlande emigriert, wo er als Direktor einer Nähanstalt in Rotterdam arbeitete. Sie wurden am 23. April 1943 mit dem 16-jährigen Sohn Wolf Hendrik Zeckel und der Schwiegermutter Henriette Goldschmidt, geboren am 16. Januar 1869 in Hildesheim, vom Durchgangslager Westerbork nach Sobibor deportiert und ermordet.
Nur Sonjas ältere Schwester Fanny überlebte die Shoah: Nach der Internierung in den Arbeitslagern Bolkenhain, Merzdorf und Schönberg wurde sie in das KZ Grünberg in Schlesien deportiert, wo sie für die "Deutsche Wollwaren Manufaktur AG" arbeiten musste, die dort in einer Textilfabrik Uniformen herstellen ließ. Zusammen mit ihrer befreundeten Mitgefangenen Cilli Königsberg gelang ihr im Januar 1945 auf einem Todesmarsch die Flucht nach Weissenfels in Thüringen. Amerikanische Truppen befreiten sie kurz vor Kriegsende. Wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes wurden beide in das Sanatorium Katz in Stuttgart-Degerloch gebracht. In einem einjährigen Aufenthalt in Italien, finanziert von der UNRA, kamen sie wieder zu Kräften. Fanny wanderte 1946 nach Palästina aus, heiratete dort und lebte als Fanny Goldschmidt in Tel Aviv.
Stand: September 2022
© Margot Löhr
Quellen: 1; 4; 5; 8; 9; StaH 133-1 III Staatsarchiv III, 3171-2/4 U.A. 4, Liste psychisch kranker jüdischer Patientinnen und Patienten der psychiatrischen Anstalt Langenhorn, die aufgrund nationalsozialistischer "Euthanasie"-Maßnahmen ermordet wurden, zusammengestellt von Peter von Rönn, Hamburg (Projektgruppe zur Erforschung des Schicksals psychisch Kranker in Langenhorn); 332-5 Standesämter 261 Sterberegister Nr. 2693/1889 David Levy Löwenthal, 328 Sterberegister Nr. 4403/1892 Pauline Löwenthal, 520 Sterberegister Nr. 1056/1903 Sarah Freyd, geb. Cohen, 726 Sterberegister Nr. 910/1915 Fanny Löwenthal, 2149 Geburtsregister Nr. 798/1887 Amalie Löwenthal, 2374 Geburtsregister Nr. 2918/1895 Paula Löwenthal, 2695 Heiratsregister Nr. 229/1886 Hermann Löwenthal/Fanny Freyd, 2714 Heiratsregister Nr. 1048/1887 Martin Löwenthal/Rebecca Freyd, 5251 Sterberegister Nr. 1037/1902 Abraham Adolf Freyd, 7134 Sterberegister Nr. 980/1932 Martin Löwenthal, 7944 Sterberegister Nr. 1273/1901 Abraham Freyd, 8073 Sterberegister Nr. 234/1923 Rebecca Löwenthal, 8164 Sterberegister Nr. 258/1939 Hermann Löwenthal, 8689 Heiratsregister Nr. 72/1913 Nuta Steinhart/Amalie Löwenthal, 8798 Heiratsregister Nr. 183/1925 Abraham Zeckel/Paula Löwenthal, 9775 Sterberegister Nr. 1502/1919 Isaac Freyd; 332-7 Staatsangehörigkeitsaufsicht, A I f 182 Nr, 661 Hermann Löwenthal, A I f 182 Nr. 658 Martin Löwenthal; 351-11, Amt für Wiedergutmachung 5736 Fanny Goldschmidt; 352-5 Zivilstandsregister-Todesbescheinigung, 1915 Sta 2a Nr. 910 Fanny Löwenthal, geb. Freyd, 1919 Sta 3a Nr. 1502 Isaac Freyd, 1923 Sta 3 Nr. 234 Rebecca Löwenthal, geb. Freyd, 1939 Sta 2a Nr. 258 Hermann Löwenthal; 522-1 Jüdische Gemeinden, Beitrittserklärungen 372 Bd. 11 Nr. 83 Abraham Freyd; Evangelische Stiftung Alsterdorf, Archiv. Wunder, Michael, Judenverfolgung in Alsterdorf, Rede zum 9. November 2013, Evangelische Stiftung Alsterdorf. Wunder, Michael, Euthanasie in den letzten Kriegsjahren. Die Jahre 1944 und 1945 in der Heil- und Pflegeanstalt Hamburg-Langenhorn, Husum 1992. Wunder, Michael/Genkel, Ingrid/Jenner, Harald, Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr. Die Alsterdorfer Anstalten im Nationalsozialismus, Hamburg 1987. Böhme, Klaus/Lohalm, Uwe (Hrsg.), Wege in den Tod. Hamburgs Anstalt Langenhorn und die Euthanasie in der Zeit des Nationalsozialismus, Hamburg 1993. Diercks, Herbert, "Euthanasie", Die Morde an Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen in Hamburg im Nationalsozialismus, Hamburg 2014 Ausstellungskatalog. Ley, Astrid/Hinz-Wessels, Annette (Hrsg.), Die Euthanasie-Anstalt Brandenburg an der Havel. Morde an Kranken und Behinderten im Nationalsozialismus, Berlin 2012. http://www.jüdischer-friedhof-altona.de/datenbank.html, Ohlsdorf 1883-1889 David Levy Löwenthal ZZ 11-309, Ohlsdorf 1890-1895 Pauline Löwenthal, geb. Hirsch ZZ 11-309; Jüdischer Friedhof Langenfelde, Rebecka Löwenthal K-176, Martin Löwenthal K-175, Freya Löwenthal K-120, Hermann Löwenthal K-119, Abraham Freyd H 63-572, Sarah Freyd, geb. Cohen H 62-650; Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Pauline Pieper, Medewerker Landelijk Steunpunt Gastsprekers, Auskünfte und Photos Familie Zeckel; https://www.joodsmonument.nl/nl/page/126042/abraham-zeckel, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/417122/henriette-zeckel-goldschmidt (Zugriff 10.10.2016); https://www.joodsmonument.nl/en/search?qsort=&qcat=&qcg=&qs=Zeckel#eyJxcyI6IlplY2tlbCIsInR5cGUiOiJsaXN0In0= (Zugriff 8.5.2014); http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-028l_S1_Chorea_2011-abgelaufen.pdf (Zugriff 16.12.2016). https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/HHJPMCKH7JWGTXXSYUABD22CND46FUYN (Zugriff 8.4.2017).
Zur Nummerierung häufig genutzter Quellen siehe Link "Recherche und Quellen".