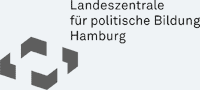Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Walter Tiedt * 1916
Weidenallee 61 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
HIER WOHNTE
WALTER TIEDT
JG. 1916
EINGEWIESEN 1922
ALSTERDORFER ANSTALTEN
HEILANSTALT LANGENHORN
"VERLEGT" 29.10.1943
MESERITZ-OBRAWALDE
ERMORDET 17.11.1943
Weitere Stolpersteine in Weidenallee 61:
Willi Karl Tiedt
Willi Karl Tiedt, geb. am 1.3.1911 in Altona, 1935 verhaftet wegen Widerstands (SPD), trotz Wehrunwürdigkeit zur Wehrmacht eingezogen, umgekommen am 27.12.1941 in Russland
Walter Robert Tiedt, geb. am 3.12.1916 in Hamburg, am 23.11.1931 eingewiesen in die damaligen Alsterdorfer Anstalten (heute: Evangelische Stiftung Alsterdorf), verlegt in mehrere andere Anstalten, zuletzt am 22.10.1943 in die Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde (heute: Szpitaldla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu-Obrzyce, Polen), dort gestorben am 17.11.1943
Weidenalle 61 (Eimsbüttel)
Die Brüder Willi Karl und Walter Robert Tiedt wurden beide infolge der Willkürmaßnahmen des nationalsozialistischen Staates ihres Lebens beraubt: der ältere, Willi Karl, 1941 bei einem militärischen Einsatz in Russland, der jüngere, Walter Robert, in der "Euthanasie"-Anstalt Meseritz-Obrawalde in der damaligen Provinz Posen.
Willi Karl Tiedt wurde am 1. März 1911 in der damals selbständigen Stadt Altona geboren, sein Bruder Walter Robert am 3. Dezember 1916 in Hamburg. Sie waren die Söhne des Tischlers Wilhelm Heinrich August Tiedt, geboren am 20. Juli 1885 in Wesenberg (Mecklenburg-Strelitz, heute: Mecklenburg-Vorpommern), und seiner Ehefrau Johanna Elisabeth Hermine, geb. Hormann, geboren am 22. Januar 1888 in Hamburg. Die Eheleute Tiedt hatten am 16. April 1910 in Hamburg geheiratet. Die Familie wohnte seit 1912 in der Weidenallee 61, zunächst im Haus 4 und dann im Haus 6, in Eimsbüttel. Der Vater verstarb bereits am 27. August 1922 im Alter von nur 37 Jahren an Lungentuberkulose.
Willi Karl Tiedt schloss die Volksschule mit der ersten Klasse ab (damals war die erste Klasse die höchste) und erlernte den Beruf des Schriftsetzers. Bis zu seiner Verhaftung im Jahre 1935 arbeitete er bei der Buchdruckerfirma Oscar de Lemos in der Bartelsstraße 92 im heutigen Stadtteil Sternschanze.
Willi Tiedt gehörte von 1926 bis 1933 der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) an, ab 1931 als deren Vorsitzender in Hamburg und blieb auch in der Illegalität ab 1933 noch einer der führenden SAJ-Funktionäre.
Nachdem sich die SAJ in Erwartung eines Verbotes freiwillig aufgelöst hatte, soll Willi Tiedt zunächst politisch nicht aktiv gewesen sein, bis er auf Hinweis des zusammen mit ihm angeklagten ehemaligen SAJ-Funktionärs Julius Willemsen Kontakt zu Walter Schmedemann, dem früheren Bürgerschaftsabgeordneten und führenden Kopf des SPD-Widerstandes in Hamburg, aufgenommen habe. In der Zeit von November 1933 bis März 1934 soll er illegale Schriften wie die "Roten Blätter", die "Sozialistische Aktion, den "Neuen Vorwärts" sowie Broschüren mit getarnten Titeln wie z.B. "Die Kunst des Selbstrasierens" (Inhalt Prager Programm der Exil-SPD, SoPaDe), "Platos Gastmahl der Liebe" und "Das Geheimnis der Kosmetik" an Julius Willemsen weitergegeben haben. Sodann seien die Schriften an weitere ehemalige SAJ- bzw. SPD-Mitglieder im Stadtteil Eimsbüttel, nach Harburg und nach Uetersen verteilt worden. Obwohl Willi Tiedt die Kurierdienste nach seinen Angaben im Frühjahr 1934 beendete und dafür sorgte, dass die Schriften direkt an Julius Willemsen gelangten, habe er nach seiner Aussage im späteren Ermittlungsverfahren u.a. auch danach noch einzelne Exemplare einer illegalen Zeitung in seinem Briefkasten gefunden.
Willi Tiedt wurde Anfang Mai 1935 verhaftet und vom 4. Mai 1935 bis November 1935 in "Schutzhaft" im KZ Fuhlsbüttel genommen. Anschließend saß er im Untersuchungsgefängnis an der Straße Holstenglacis ein.
Der Generalstaatsanwalt beim Hanseatischen Oberlandesgericht warf ihm und elf weiteren Angeklagten (Prozess Hencke und Genossen O. Js. 267/35) in der Anklageschrift vom 16. September 1935 vor, sich in einer Gruppe früherer Mitglieder der ehemaligen SAJ sowie einer Gruppe ehemaliger Mitglieder der SPD in den Jahren 1933, 1934 und 1935 im Stadtteil Eimsbüttel betätigt zu haben. Die Aktivitäten der Gruppe seien darauf gerichtet gewesen, einen organisatorischen Zusammenhalt herzustellen oder aufrechtzuerhalten und durch Herstellung und Verbreitung von Schriften die Massen zu beeinflussen.
Das Hanseatische Oberlandesgericht verurteilte Willi Tiedt am 5. November 1935 zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und drei Monaten sowie zum Verlust der Wehrwürdigkeit wegen "Vorbereitung zum Hochverrat". Die anderen Angeklagten erhielten Freiheitsstrafen zwischen einem Jahr, neun Monaten Gefängnis und fünf Jahren Zuchthaus.
Unter Berücksichtigung der Untersuchungshaft wurde Willi Tiedt am 5. August 1936 aus der Haft entlassen. Er war danach mit kurzen Unterbrechungen bis Oktober 1937 arbeitslos. Die Gestapo legte Willi Tiedt nahe, einen Antrag auf Wiedererlangung der Wehrwürdigkeit zu stellen. Obwohl er ablehnte, wurde er nach Kriegsbeginn zur regulären Wehrmacht eingezogen und zusammen mit anderen politisch Verfolgten zu besonders gefährlichen Einsätzen abkommandiert.
Willi Karl Tiedt verlor sein Leben bei einem militärischen Einsatz am 27. Dezember 1941 in Rjabinicka in Russland. An ihn erinnert neben dem Stolperstein in der Weidenallee 61 ein Grabstein auf dem Ehrenfeld der Geschwister-Scholl-Stiftung für ehemalige Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer auf dem Friedhof Ohlsdorf (Grab Nr. Bo 73 144).
Willi Karl Tiedts Bruder Walter Robert wurde am 16. November 1922 im Alter von sechs Jahren zum ersten Mal in den Alsterdorfer Anstalten (heute: Evangelische Stiftung Alsterdorf) aufgenommen und blieb dort bis zum 17. Februar 1923.
Vom 1. August 1923 bis zum 15. Juli 1928 war Walter Tiedt Patient in der Staatskrankenanstalt Friedrichsberg. Die Gründe für die Unterbringung in Alsterdorf und in Friedrichsberg sind nicht bekannt. Wir wissen auch nicht, ob Walter Tiedt nach seiner Entlassung aus Friedrichsberg bei seiner inzwischen verwitweten Mutter lebte.
Am 23. November 1931 wurde Walter Tiedt – er war nun fast fünfzehn Jahre alt – erneut Patient der Alsterdorfer Anstalten. Dort charakterisierte das Personal ihn als eigensinnig. Er habe wenig Interesse an seiner Umgebung gezeigt. Zwar habe er seinen Namen richtig nennen können, nicht jedoch sein Alter, und er habe fast keinen der einfachsten Gegenstände des täglichen Lebens bezeichnen können. Auf Bildern jedoch habe er die Feuerwehr, einen Eisenbahnzug und Laternen der Kinder erkannt. Walter Tiedt habe auch nicht schreiben können. Als Diagnose wurde "Idiotie" gestellt (veralteter Begriff für eine schwere Form der Intelligenzminderung).
Am 19. Februar 1941 wurde Walter Tiedt in die Heil- und Pflegeanstalt Hamburg-Langenhorn verlegt, weil er – wie es in seiner Patientenakte heißt – "wegen häufiger Erregungszustände, in denen er als gemeingefährlich anzusehen ist, nicht mehr für die Alsterdorfer Anstalten tragbar ist, da geeignete Schutzmaßnahmen für derartige Kranke dort nicht vorhanden sind."
Wenige Wochen später, am 27. März 1941, wurde er von Langenhorn in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt Neustadt gebracht. Auch dort durfte er nur wenige Wochen bleiben. Er kam am 3. Mai 1941 zurück nach Langenhorn und zwei Tage später, am 5. Mai 1941, in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. Über sein Leben dort ist nur überliefert, dass er "gierig" auf das Essen gewesen sei und durch lautes Sprechen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken versucht habe.
Walter Tiedt kam am 9. September 1943 zurück nach Langenhorn und wurde von dort am 22. Oktober 1943 zusammen mit weiteren 49 männlichen Patienten in die Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde in der damaligen Provinz Brandenburg abtransportiert.
Die Anstalt Meseritz-Obrawalde wurde ab Herbst 1941, also wenige Monate nach dem offiziellen Stopp der ersten Phase der "Euthanasie" ("Aktion-T4") zur Vernichtungsanstalt umorganisiert. Die Angaben zur Zahl der dort Ermordeten unterscheiden sich je nach Quelle. So gab eine Oberpflegerin vor einem russischen Militärtribunal im April 1945 die Zahl der in Meseritz-Obrawalde getöteten Patienten mit 18.000 an. Aufgrund der vorgefundenen Register nannte eine Untersuchungskommission der russischen Armee 700 Todesfälle für das Jahr 1942, 2.260 Todesfälle für das Jahr 1943 und 3.814 Todesfälle für das Jahr 1944.
Von den 50 Patienten aus Langenhorn starben 43 bis Februar 1945. Walter Tiedt kam dort am 17. November 1943 ums Leben.
Stand: August 2021
© Ingo Wille
Quellen: Adressbuch Hamburg 1931; StaH 332-5 Standesämter 3147 Heiratsregister Nr. 287/1910 Wilhelm Heinrich August Tiedt/ Johanna Elisabeth Hermine Hormann, 8070 Sterberegister Nr. 330/1922 Wilhelm Heinrich August Tiedt, 8170 Sterberegister Nr. 250/1942 Willi Karl Tiedt; 351-11 Amt für Wiedergutmachung 10804 Willi Tiedt; 352-8/7 Staatskrankenanstalt Langenhorn 28301 Walter Tiedt; Evangelische Stiftung Alsterdorf, Archiv Sonderakte V 276 Walter Tiedt; Gedenkbuch Euthanasie – Die Toten 1939-1945, Hamburg 2017, S. 55, 544; Michael Wunder, Die Transporte in die Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde, in: Peter von Rönn u.a., Transport in den Tod – Hamburgs Anstalt Langenhorn und die Euthanasie in der Zeit des Nationalsozialismus, Hamburg 1993, S. 377 ff.; Archiv Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Sign. 833-8, SPD-1933-1945, Prozesse, Prozess Hencke und Genossen, 267/35 OJS; Christel Oldenburg u.a., Für Freiheit und Demokratie, Hamburger Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Verfolgung und Widerstand 1933-1945, Hamburg 2003; Ursel Hochmuth/Ursula Suhling, Ehrenfeld für Verfolgte der NS-Herrschaft, Hamburg 2012, S. 100; Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten Hamburg (AvS), "Dass die Frage der Wiedergutmachung ... zu einem öffentlichen Skandal geworden ist". Zur Tätigkeit der ehemals verfolgten Sozialdemokraten 1945-2005, Hamburg 2008; Harald Jenner, Die Heil- und Pflegeanstalt Mesetz-Obrawalde – Der unbekannte Tötungssort, in: "Euthanasieverbrechen"-Verbrechen im besetzten Europa, Hrsg. Osterloh, Schulte, Steinbacher, Göttingen 2022, S. 97 ff.