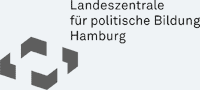Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Eduard Ripperger * 1902
Fettstraße 1 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
HIER WOHNTE
EDUARD RIPPERGER
JG. 1902
EINGEWIESEN 1921
ALSTERDORFER ANSTALTEN
"VERLEGT" 27.11.1941
HEILANSTALT TIEGENHOF
ERMORDET 21.5.1942
Eduard Arnold Christian Ripperger, geb. am 26.7.1902 in Altona, "verlegt” am 28.7.1941 aus den damaligen Alsterdorfer Anstalten in die Heil- und Pflegeanstalt Hamburg-Langenhorn, von dort am 27.11.1941 abtransportiert in die Gau-Heilanstalt Tiegenhof bei Gnesen (Gniezno), ermordet am 21.5.1942
Fettstraße 1
Eduard Arnold Christian Ripperger war am 26. Juli 1902 in der damals noch selbstständigen Stadt Altona als Sohn des Arbeiters Louis Ferdinand Rudolph Wilhelm Ripperger (geb. 7.11. 1872 in Altona) und dessen Ehefrau Dorothea Josephine Caroline, geborene Zoost (geb. 14.6.1870 in Altona) zur Welt gekommen. Beide Eltern bekannten sich zur lutherischen Konfession.
Die Eheleute Ripperger bekamen insgesamt sieben Kinder, von denen neben Eduard Arnold Christian jedoch nur zwei das Erwachsenenalter erlebten, Theodor Heinrich Ludwig Karl Ferdinand, geboren 15. Oktober 1903, und Otto Bernhard Friedrich Ripperger, geboren 31. Oktober 1915.
Die Familie Ripperger lebte viele Jahre in der Straße Große Freiheit, Hausnummer 55, Haus 4, der heutigen Vergnügungsstraße im Stadtteil St. Pauli. Hier wurden auch die Kinder geboren. Deren Mutter starb im Alter von 48 Jahren am 18. Oktober 1918. Der jüngste Sohn, Otto Bernhard Friedrich Ripperger, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz drei Jahre alt. Zwei Jahre später, am 31. Januar 1920 heiratete Louis Ferdinand Rudolph Wilhelm Ripperger ein zweites Mal. Seine neue Ehefrau war Caroline Wilhelmine Lucia geborene Hagge, geschiedene Gosch, geboren am 18. Februar 1876.
Über das Leben von Eduard Ripperger wissen wir nur das Wenige, das sich aus dem Aufnahmebuch der Alsterdorfer Anstalten ergibt bzw. auf einer Karteikarte vermerkt ist, die für das ab 1934 aufgebaute Hamburger Gesundheitspassarchiv zum Zwecke der "erbbiologischen Bestandaufnahme" der Bevölkerung angelegt worden ist. Danach wurde er erstmalig am 19. Januar 1920 in den Alsterdorfer Anstalten aufgenommen. Die Ursache ist nicht überliefert.
Kurze Zeit später, am 11. Juni 1920, wurde er wieder entlassen, wahrscheinlich zu seinen Eltern, und am 14. September 1921 erneut aufgenommen. Lt. Karteinotiz soll "besonders in den letzten zehn Jahren ein ganz deutlicher Rückgang in jeder Beziehung zu verzeichnen" gewesen sein. "Während er früher noch zu einfachen Handreichungen zu gebrauchen war, […] hatte er keinerlei Beziehungen zu seiner Umwelt mehr. Er war daher als unheilbar krank anzusehen". Er sei zu keiner produktiven Arbeit fähig gewesen.
Insbesondere der Hinweis, er sei zu keiner produktiven Arbeit verwendbar gewesen, dürfte für sein Schicksal ausschlaggebend gewesen sein. Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen hatten während der NS-Zeit dann eine Chance zu überleben, wenn sie fähig waren, ihre eigenen Unterhaltskosten und möglichst weitere Erträge durch Arbeit zu erwirtschaften. Den anderen drohte als "Lebensunwerten" in der "Euthanansie"-Aktion bis August 1941 der Tod durch Gas und später durch Verhungernlassen oder durch zu hohe Medikamentendosierungen z.B. von Luminal oder Skopolamin.
Eduard Ripperger gehörte zu den 70 in Alsterdorf lebenden Menschen, die am 28. Juli 1941 mit Bussen der "Gemeinnützigen Krankentransport-Gesellschaft" (GeKraT) aus Alsterdorf abgeholt und in die Heil- und Pflegeanstalt Hamburg-Langenhorn transportiert wurden. Von dort wurden 66 der Alsterdorfer Anstaltsinsassen weiterdeportiert (vier starben unter den Bedingungen mangelnder Pflege in Langenhorn), und zwar in die Gau-Heilanstalt Tiegenhof bei Gnesen (Gniezno) im besetzten Polen. Nur einer aus diesem Transport überlebte.
Eduard Ripperger starb dort am 21. Mai 1942, lt. Sterberegistereintrag an "fieberhaftem Darmkatarrh".
Auch Eduard Rippbergers Bruder Otto Bernhard Friedrich geriet ins Visier des NS-Staates: Er war in den 1930er Jahren wegen Diebstahls mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten und wurde 1936 gegen seinen Willen auf Beschluss des früheren Erbgesundheitsgerichtes wegen "angeborenen Schwachsinns" sterilisiert. Von 1940 bis 1945 hatte er bei der Polizei "gedient". Nach dem Krieg kämpfte er bis 1956 um die "Wiederherstellung des früheren Standes". Durch die Sterilisierung habe er die ganzen Jahre eine seelische "Last mit sich herumgetragen". Er argumentierte, der Sterilisationsgrund "Schwachsinn" sei ihm bei den Verurteilungen nicht als mildernder Umstand zugebilligt worden. Sein Entschädigungsantrag wurde abgelehnt, da nach dem Bundesentschädigungsgesetz nur die Verfolgung aus rassischen, politischen oder weltanschaulichen Gründen anerkannt wird.
Stand: Januar 2020
© Ingo Wille
Quellen: StaH 332-5 Standesämter 14360 Elise Therese Marie Christiane Ripperger, 14580 Christiane Dorothea Frieda Ripperger, 13981 Theodor Hinrich Ludwig Karl Ferdinand Ripperger, Altona Nr. 2433/1906 Arnold Johann Gustav Ripperger, Nr. 1816/1915 Altona Otto Bernhard Friedrich Ripperger, Hamburg Nr. 68/1929 Louis Ferdinand Rudolph -Wilhelm Ripperger/Caroline Wilhelmine Lucia geb. Hagge verw. Petzendorfer gesch. Gosch, Altona I Nr. 2169/1902 Eduard Arnold Christian Ripperger; 351-11 Amt für Wiedergutmachung 40958 Otto Ripperger; Standesamt Gnesen Sterberegistereintrag Eduard Arnold Christian Ripperger.