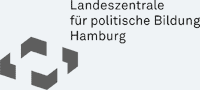Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Rebecca Selke (geborene Spanier) * 1881
Bismarckstraße 6 (Eimsbüttel, Hoheluft-West)
HIER WOHNTE
REBECCA SELKE
GEB. SPANIER
JG. 1881
DEPORTIERT 1941
ERMORDET
RIGA
Weitere Stolpersteine in Bismarckstraße 6:
Iwan Selke
Iwan Selke, geb. 10.6.1876 in Hamburg, deportiert 6.12.1941 nach Riga, ermordet
Rebecca Selke, geb. Spanier, geb. 12.4.1881 in Burgdamm, deportiert 6.12.1941 nach Riga, ermordet
Bismarckstraße 6
Iwan Selke war der jüngste der vier Söhne des Händlers Selke Elias Selke (geb. 16.2.1833 in Glückstadt an der Unterelbe), und seiner Ehefrau Sophie Behrens (geb. 16.10.1834 in Hamburg). Iwan blieb als einziger in Hamburg. Dadurch wuchs ihm quasi die Rolle des Familienoberhaupts zu. Sein ältester Bruder Theodor (23.2.1865) war elf Jahre älter als er. Sechs Jahre älter war Julius (Februar 1869-24.7.1888). Er starb mit nur 19 Jahren. Der dritte Bruder, Ludwig (9.11.1874), war nur eineinhalb Jahre älter als Iwan (10.6.1876-1942).
Theodor und Ludwig Selke verließen Hamburg noch im 19. Jahrhundert. Theodor war Zahntechniker geworden und wanderte zusammen mit seiner Schwester Frieda (1867-11.4.1900) 1887 in die USA aus, Ludwig arbeitete in Odessa als Bankbeamter.
Außer Frieda gab es vier weitere Schwestern: die Händlerin Marie/Mary (21.4.1863-9.10.1941), die Verkäuferin Eveline (3.8.1872-1942), die Kontoristin Olga (6.2.1878-5.12.1941) und Rosa (15.11.1879-13.11.1947).
Selke Elias Selke, kurz S.E. Selke, war um 1850 nach Hamburg gekommen, als die Mehrzahl der Glückstädter Juden die Stadt verließ. Nach seiner Einbürgerung am 19. Oktober 1860 hatte er Sophie Behrens geheiratet. Am 11. Dezember 1863 beantragte er eine Konzession für eine Manufakturwarenhandlung in St. Georg, der östlichen Vorstadt von Hamburg, in der Neustraße 45. Ab 1868 betrieb er ein zweites Geschäft für Band-, holländische und Manufakturwaren in der Hamburger Neustadt im Neuen Steinweg 98, 1871 gab er das erste Geschäft auf.
S.E. Selke wechselte von der Neustadt nach St. Pauli und richtete sich in der Bartelsstraße 46 wieder auf Dauer ein. Er passte sein Warenangebot dem neuen Standort an, indem er Weißwaren und Putzartikel aufnahm. Mit dem nächsten Umzug 1897 nach Eimsbüttel in die Altonaer Straße 44 passte er noch einmal sein Geschäft der neuen Umgebung an und arbeitete schließlich nur noch in Kommission.
Keines der Kinder stieg in das Geschäft ein. Iwan und Olga Selke lebten bis zum Tod ihrer Eltern mit ihnen zusammen. Sie blieben zeitlebens Anlaufstelle für ihre Kinder.
Als Iwan zehn Jahre alt war, heiratete seine älteste Schwester, Marie/Mary, am 21. Oktober 1886 den Kaufmann Levi Lievendag, mit dem sie neun Kinder bekam; fünf von ihnen erreichten das Erwachsenenalter.
Theodor Selke, inzwischen naturalisierter US-Bürger, kehrte im Januar 1894 besuchsweise nach Hamburg zurück, um Bertha Hertz (geb. 1.3.1871) zu heiraten. Die Eheschließung fand am 28. Februar 1894 statt. Danach verliert sich ihre Spur.
Ludwig Selke heiratete ebenfalls in Hamburg. Er schloss am 5. Januar 1901 die Ehe mit der am 17.5.1877 in Warschau geborenen Jenny Lewin. Sie behielten ihre deutsche Staatsangehörigkeit und zogen nach Odessa, wo ihre fünf Kinder zur Welt kamen.
Die Eltern erlebten im Januar 1905 die Scheidung von Marie/Mary Lievendags Ehe und ihre Wiederverheiratung zwei Jahre später mit dem Möbelhändler Friedrich Johannes Karl Burwitz (geb. 25.5.1852).
1906 gründete Iwan Selke eine Export-Agentur mit Sitz in der Knochenhauerstraße 9, die er im Handelsregister eintragen ließ. Seine Wohnadresse blieb die Altonaerstraße 44. Er gehörte der Jüdischen Gemeinde bis zu seiner Deportation im Jahr 1941 an.
Sein Bruder Ludwig kam 1908 besuchsweise mit seiner Familie zu den Eltern und blieb über ihren Tod hinaus in Hamburg. Die Mutter Sophie Selke starb am 25. März 1908 im Alter von 73 Jahren, der Vater Selke Elias Selke ein halbes Jahr später, am 23. September 1908, 75 Jahre alt. Die Eltern wurden in einem Doppelgrab auf dem Jüdischen Friedhof an der Ilandkoppel in Ohlsdorf beigesetzt.
Nach dem Tod der Eltern zog Iwan Selke in die Reuterstraße 4 auf der Uhlenhorst und verlegte 1909 den Firmensitz in die Große Reichenstraße 15/17. Er teilte die Wohnung mit seinem Bruder, der wieder als Kaufmann tätig wurde, und dessen Familie. Sie zogen auch gemeinsam im folgenden Jahr in die Hasselbrookstraße 49 in Hamburg-Eilbek. Am 29. August 1910 meldete Ludwig Selke sich wieder nach Odessa ab.
Nach seinen Geschwistern Marie, Theodor und Ludwig heiratete am 12. Februar 1911 auch Iwan Selke, inzwischen 35 Jahre alt. Seine Ehefrau, Rebecca, genannt Ekka, geb. Spanier, (geb. 12.4.1881 in Burgdamm bei Bremen), lebte mit ihrer Schwester Bella, geb. 25.2.1884, und den Eltern Jacob Spanier und Caroline, geb. Neumark, in der Tegethoffstraße 9 in Eimsbüttel.
Als Bella und Rebecca Spanier noch Kinder waren, war ihr Vater nach Hamburg übergesiedelt. Im Adressbuch von 1887 ist er als Kaufmann mit der Adresse Carolinenstraße, Holstenthorstraße Haus 2, eingetragen. Kurz darauf zog er nach Hamburg-Eimsbüttel in die Tegethoffstraße 9, was die Familienadresse bis 1941 blieb. Welche Schulen die Schwestern besuchten, ist nicht bekannt. Bella Spanier (siehe www.stolpersteine-hamburg.de) wurde Lehrerin und unterrichtete an der Volksschule Rosenallee 11 im Münzviertel in Hamburg-St. Georg.
Iwan und Rebecca Selke blieben nach ihrer Heirat in Eimsbüttel und zogen auf Dauer in die Bismarckstraße 6. Sie führten ein gutbürgerliches Leben. Im Sommer 1915 wurde Iwan Selke im Alter von 39 Jahren zum Kaiserlichen Heer eingezogen.
Noch vor Ende des Ersten Weltkriegs starb Rebeccas Vater, Jacob Spanier.
Ohne jedes Einkommen, summierten sich Iwan Selkes Steuerrückstände bei der Jüdischen Gemeinde. Sie wurden ihm später erlassen. Bis zur Weltwirtschaftskrise erzielte er jährlich ein steuerpflichtiges Einkommen und kam seinen Gemeindesteuern in vollem Umfang nach. Die Ehe blieb kinderlos.
Im Alter von fast 48 Jahren heiratete Iwan Selkes Schwester Eveline den gleichaltrigen gelernten Uhrmacher, Kaufmann und Reisenden Julius Osiakowski (10.2.1872). Ihre Ehe wurde am 27. Januar 1920 geschlossen.
Am Ende der Inflationszeit verlegte Iwan Selke seine Firma in die Große Bäckerstraße 6/10. Bis zur Weltwirtschaftskrise erholte sich sein Geschäft wieder. Er unternahm Reisen, ab 1924 mit seiner Frau Rebecca mit einem gemeinsamen Reisepass. Doch die Weltwirtschaftskrise ließ seine geschäftlichen Tätigkeiten wieder einbrechen, er gab den Firmensitz auf und arbeitete nur noch von zu Hause aus.
Eveline Selke hatte sich 1909 mit einem Haushaltswarengeschäft in Hamburg-Hamm selbstständig gemacht, das nach ihrer Heirat an den Ehemann überging. Es hatte durch die Inflationszeit hindurch Bestand, geriet dann aber in der Weltwirtschaftskrise in die Insolvenz. Ihr Bruder Iwan half mit kleinen Krediten, was aber nicht verhinderte, dass sich Julius Osiakowski an die Fürsorge wenden musste.
Das betraf in unterschiedlichem Maße alle noch in Hamburg lebenden Geschwister, da sie weder Vermögen noch hinreichende Rentenansprüche hatten und aus Altersgründen nicht mehr voll arbeitsfähig waren: Marie/Mary Burwitz’ Ehemann war seit 1910 unauffindbar, sie brachte ihre Kinder als Händlerin, Handarbeitslehrerin und Näherin durch. Ihre Söhne konnten später nur mit Mühe ihre eigenen Familien ernähren.
Eine einmalige Unterstützung aus den USA kam 1928 aus New York von Rosa Selke, die ihrer Schwester Marie/Mary ein Paket mit Kleidung schickte. Das ist die einzige Spur von ihr und von den amerikanischen Verwandten. Zu ihnen gehörten seit Anfang der 1930er Jahre auch Ludwig und seine Familie, die aus dem Baltikum und aus Danzig in die USA emigriert waren.
Bertha Peiser, geb. Osiakowski, war seit 1911 verwitwet und finanziell schlecht gestellt, ebenso wie Olga Selke, die 1929 ihre Arbeit als Kontoristin und Korrespondentin verloren hatte.
Außer Iwan Selke hatte nur noch Iwan Osiakowski, Evelines Schwager, ein regelmäßiges Einkommen aus seinem Lotteriegeschäft in der Tresckowstraße 43 in Eimsbüttel. Als er am 28. April 1938 starb, hinterließ er seine Witwe Berthe, geb. Lewie, geb. 8.1.1870 in La Chaux de Fond in der Schweiz und ihre Tochter Paula, geb. 15.11.1902, mittellos.
Olga Selkes Lage besserte sich etwas, als sie 1938 eine Altersrente von monatlich 47 RM erhielt. Sie trat 1939 in die Jüdische Gemeinde ein, als der NS-Staat dies von allen Jüdinnen und Juden forderte.
Es gibt keinerlei Hinweise auf Emigrationspläne der hier Genannten.
Noch vor dem Beginn der Herbstdeportationen 1941 starb Iwan Selkes älteste Schwester Marie/Mary Burwitz im Alter von 78 Jahren eines natürlichen Todes.
Seine Schwester Olga nahm sich am 5. Dezember 1941, dem Vorabend der vierten Deportation, die nach Riga führte, in ihrer Wohnung in der Innocentiastraße 37 das Leben. Beide wurden auf dem Jüdischen Friedhof an der Ilandkoppel beerdigt.
Zur ersten Deportation am 25. Oktober 1941 von Hamburger Juden und Jüdinnen zum Aufbau im Osten, die das Getto von Litzmannstadt/Lodz zum Ziel hatte, wurde Bella Spanier, Rebecca/Ekka Selkes jüngere Schwester, aufgerufen.
Die vom Reichssicherheitshauptamt der örtlichen Gestapo in den Richtlinien vorgegebene Altersgrenze von 60 bzw. 65 Jahren für die Großdeportationen 1941 wurde nicht strikt eingehalten, besonders, wenn es sich um Verwandte handelte, wie sich bei dem Transport am 6. Dezember 1941 nach Riga zeigte: Mit diesem Transport wurden Rebecca und Iwan Selke, 60 und 65 Jahre alt, aus der Bismarckstraße 6, und Berthe Osiakowski mit ihrer Tochter Paula aus der Tresckowstraße 43, 71 und 39 Jahre alt, nach Riga deportiert. Sie, wie die meisten der im Herbst 1941 deportierten Personen, erhielten ihren Befehl zur "Evakuierung" noch an ihren langjährigen Wohnadressen.
Was Rebecca und Iwan Selke noch an Guthaben hatten, wurde am 15. Januar 1942 beschlagnahmt und dem Oberfinanzpräsidenten überwiesen. Es handelte sich um Iwan Selkes Bankguthaben in Höhe von 937,50 RM und ein Guthaben Rebeccas von 2732,44 RM, worin der Versteigerungserlös für den Hausstand von 1321,35 RM enthalten war. Da es keine Erben gab, bei niemandem aus den Familien Selke und Spanier und Osiakowski, wurden 1958 die Guthaben dem Globalabkommen mit dem Bundesfinanzminister zugeschlagen.
Von den Geschwistern lebte niemand mehr in Hamburg, als Eveline und Julius Osiakowski am 15. Juli 1942 ins "Altersgetto" von Theresienstadt deportiert wurden. (siehe www.stolpersteine-hamburg.de)
Niemand der Genannten erfuhr etwas vom Schicksal der Angehörigen oder überlebte die Deportation.
Stand: Februar 2022
© Hildegard Thevs
Quellen: 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; Hamburger Adressbücher; StaHH Bürgerregister; 213-13 Rückerstattungssachen, 15803, 16892, 17054, 18382; 335-2, Personenstandsbücher; 351-14 Fürsorge, 1029, 1651, 1677, 1835; 376-2 Gewerbeanmeldung, VIII C 77 Nr. 6770; 411-1, XXXV III 4132; http://www.igdj-hh.de/friedhofsdatenbank.html; https://www.jüdische-gemeinden.de/index.php/gemeinden/k-l/1021-kalisch-suedpreussen; https://www.jüdische-gemeinden.de/index.php/gemeinden/e-g/737-glueckstadt-schleswig-holstein.
Zur Nummerierung häufig genutzter Quellen siehe Link www.stolpersteine-hamburg.de/Recherche und Quellen.