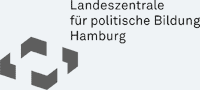Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Ruth Mannheim * 1928
Schäferstraße 8 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
HIER WOHNTE
RUTH MANNHEIM
JG. 1928
DEPORTIERT 1942
ERMORDET IN
AUSCHWITZ
Weitere Stolpersteine in Schäferstraße 8:
Walter Mannheim , Eva Mannheim , Hertha Mannheim , Vilma (Wilma) Mannheim
Walter Mannheim, geb. am 4.3.1890 (oder 1891) in Ahlden, deportiert am 11.7.1942 nach Auschwitz
Eva Mannheim, geb. Lachmann, geb. am 23.9.1895 in Berlin, deportiert am 11.7.1942 nach Auschwitz
Hertha Mannheim, geb. am 31.3.1922 in Ahlden, deportiert am 11.7.1942 nach Auschwitz
Wilma Mannheim, geb. am 21.6.1924 in Celle, deportiert am 11.7.1942 nach Auschwitz
Ruth Mannheim, geb. am 13.4.1928 in Celle, deportiert am 11.7.1942 nach Auschwitz
Schäferstraße 8
Der Ingenieur Walter Mannheim, seine Ehefrau Eva und die Töchter waren die letzten jüdischen Bürgerinnen und Bürger der kleinen Gemeinde Ahlden. Ahlden, links der Aller zwischen Celle und Verden gelegen, hatte 1885 etwas über 800 Einwohner, von denen 18 jüdisch waren. Ende des 19. Jahrhunderts gab es nur noch wenige Juden im Ort. Albert Mannheim, der 1892 starb, war der letzte Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde gewesen. Er stammte aus Eldagsen. Walter Mannheim war sein Enkel. Er wurde 1890 (oder 1891) in Ahlden geboren. 1903 lebte hier nur noch die jüdische Familie Isidor Mannheim, Walters Vater. Auch die älteste Tochter von Walter und Eva Mannheim, Hertha, kam dort zur Welt. Die zweite und dritte Tochter wurden in Celle geboren. Aus einer Notiz im Stadtarchiv Celle geht hervor, dass Ruth Mannheim in der Landesfrauenklinik Celle geboren wurde, die Eltern aber in Ahlden wohnten.
Walter Mannheim besuchte das Technikum Mittweida. Wir wissen nicht, welcher Tätigkeit er in Ahlden nachgegangen ist. Es gibt den Hinweis, dass er 1936 von der Stapo Lüneburg als Motorradfahrer registriert wurde. Vielleicht arbeitete er in Celle oder Verden und fuhr mit dem Motorrad dorthin. 1937 meldete sich die Familie mit den zwei Töchtern Wilma und Ruth nach Hamburg ab. Die älteste Tochter Hertha hatte den Ort vermutlich schon vorher verlassen, um zu arbeiten oder eine Ausbildung zu machen. Mit dem Umzug der Familie war die Gemeinde "judenfrei". Ob Mannheims von ihren Nachbarn in Ahlden verfolgt und schikaniert worden waren, wissen wir nicht.
Seit Dezember 1939 arbeitete Walter Mannheim in Hamburg als Ausbilder in der Schlosserlehrwerkstatt der Werkschule der Hamburger Volks- und Höheren Schule für Juden, wie die jüdische Schule nach Zusammenlegung der Talmud Tora Schule und der Schule Karolinenstraße hieß. Die Lehrwerkstätten für Tischler und Schlosser in der Weidenallee waren 1934 eingerichtet worden. Die Wohnung in der Schäferstraße war nicht weit von der Lehrwerkstatt entfernt.
Eva Mannheim wurde als Eva Lachmann in Berlin geboren. Bevor sie Walter Mannheim heiratete, hatte sie das Lehrerinnenseminar in Berlin besucht.
Die fünfköpfige Familie wurde im Juli 1942 nach Auschwitz deportiert. Auf der Deportationsliste war für Hertha Mannheim als letzte Adresse Johnsallee 54 angegeben; als Berufsbezeichnung war Hausangestellte verzeichnet. Für Walter Mannheim war als Wohnung das "Judenhaus" Agathenstraße 3 genannt, Eva, Wilma und Ruth hatten danach weiterhin in der Schäferstraße 8 gewohnt.
Eva Mannheim hatte mindestens zwei Geschwister, die emigrieren konnten: Der ein Jahr ältere Bruder Rudolf (Rodolfo) Lachmann (geb. 12.5.1894 in Berlin) war Architekt und lebte später in Brasilien. Er hinterlegte in der Gedenkstätte Yad Vashem 1973 Gedenkblätter für Walter und Eva Mannheim. Die jüngere Schwester Mathilde Rabinowitz, geb. Lachmann (geb. 19.8.1898 in Berlin), lebte später in Rhodesien. Vermutlich war Kurt Lachmann (geb. 20.3.1893 in Berlin) ein weiterer Bruder. Er wurde am 28. März 1942 ins Getto Piaski deportiert und ermordet. Eva Mannheims Mutter war wahrscheinlich Frieda Lachmann, geb. Ginsberg (geb. 15.9.1868 in Berlin), die am 19. April 1943 von Berlin nach Theresienstadt deportiert wurde.
© Susanne Lohmeyer
Quellen: 1; 4; 5; 8; 9 StaH 351-11 AfW, 17678 und 12924; StaH 522-1 992e 2; HAB IV 1940; Herbert Obenaus, Historisches Handbuch, Bd. 1, S. 103ff.; Auskunft Stadtarchiv Celle vom 23.4.2012; Peter Offenborn, Jüdische Jugend, S. 1218.
Zur Nummerierung häufig genutzter Quellen siehe Link "Recherche und Quellen".