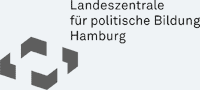Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Peter Perls * 1931
Weidenstieg 8 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
1943 Theresienstadt
ermordet in Auschwitz
Peter Perls, geb. am 29.10.1931 in Schkeuditz, deportiert nach Theresienstadt am 23.6.1943, deportiert nach Auschwitz am 23.10.1944, dort ermordet
Weidenstieg 8
In einer Liste für den Transport von Hamburg nach Theresienstadt am 23. Juni 1943, auf der 109 Namen standen, tauchte unter der Adresse Weidenstieg 8 der Name Peter Perls auf. Peter war der Einzige auf der Aufstellung mit diesem Nachnamen, obwohl er erst elf Jahre alt war. Er musste Hamburg mutterseelenallein ohne Begleitung eines Angehörigen verlassen.
Seine Eltern Hans Perls und Käthe Perls, geb. Goldmann, hatten im Mai 1926 in Hamburg geheiratet, aber die Mutter (Jg. 1900) war im Mai 1933 im Alter von nur 32 Jahren in Schkeuditz an Brustkrebs gestorben. Peter war bei ihrem Tod zweieinhalb Jahre alt, sein Bruder Jürgen, im Februar 1928 geboren, war damals fünf Jahre alt. Im letzten Jahr der Krankheit ihrer Mutter lebten die Söhne zeitweise bei den Großeltern Goldmann, Käthes Eltern, in Hamburg. Käthe Perls wurde auf dem Friedhof Ohlsdorf begraben.
Peters Vater Hans Perls, geboren am 26.5.1900 in Kattowitz, war Nervenarzt. 1924 war er in Jena approbiert und promoviert worden, anschließend hatte er im Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf als Volontärassistent gearbeitet. In dieser Zeit lernte er vermutlich seine spätere Frau Käthe kennen. Von 1925 bis 1933 arbeitete er als Nervenarzt in Schkeuditz im Knappschaftskrankenhaus "Bergmannswohl". Schkeuditz ist eine Kleinstadt zwischen Leipzig und Halle. Bei der Volkszählung 1932 lebten dort 42 Juden. 1933 wurde Hans Perls aus seiner Stellung im Krankenhaus entlassen, weil er Jude war. Er ließ sich als Facharzt für Nervenkrankheiten in Leipzig mit eigener Praxis nieder. 1934 und 1935 hatte er seine Praxis- und Wohnadresse in der Funkenburgstraße 5. 1935 war er dann als jüdischer Arzt ohne Kassenzulassung registriert. In Leipzig gehörte er dem Jüdischen Kulturbund an, ebenso wie seine zweite Ehefrau Hildegard Perls. Von Leipzig zog er nach Berlin und emigrierte 1936 illegal über Italien nach Palästina. Mit ihm gingen der ältere Bruder von Peter Perls, Jürgen (später Yochanan), und seine zweite Ehefrau, die auch zwei Kinder hatte. Zwar behandelte Hans Perls in Palästina noch Patienten, es gelang ihm aber nicht, die hebräische Sprache zu erlernen, so dass er beruflich nicht noch einmal Fuß fassen konnte. Seine zweite Ehefrau ernährte die Familie mit einem Geschäft für Bettfedernreinigung, das sie mit ihrer Schwester betrieb. Hans Perls starb 1967 in Tel Aviv; heute leben seine Schwiegertochter, seine Enkel und Urenkel in der Nähe der Stadt.
Während sein Vater und seine (Stief-)Geschwister emigrierten, blieb Peter Perls in Hamburg bei seinen Großeltern Hugo und Auguste Goldmann zurück. Auguste Goldmann war gebürtig aus Bremen, nichtjüdisch und Protestantin, ihr Ehemann war Jude und in Polen geboren. Hans Perls wähnte seinen kleinen Sohn bei der "arischen" Großmutter in Sicherheit, eine fatale Verkennung der Situation. Nach der nationalsozialistischen Rasseideologie war Peter "Halbjude", da aber drei seiner vier Großeltern jüdisch waren, wurde er als "Geltungsjude" behandelt.
Im April 1938 wurd Peter eingeschult. Ab dem 15. November 1938 durften jüdische Schüler öffentliche Schulen nicht mehr besuchen, und auch vorher wurden sie nur aufgenommen, wenn die "Judenquote" von fünf Prozent noch nicht erreicht war. Peter ging auf die damals bereits ausschließlich von jüdischen Schülern besuchte Grundschule von Cläre Lehmann in der Heilwigstraße 46. (Zu Cläre Lehmann und der Geschichte ihrer Schule s. "Stolpersteine in Hamburg-Eppendorf und Hamburg-Hoheluft-Ost", S. 242ff.) 1938 besuchten neun Kinder, fünf Jungen und vier Mädchen, die erste Klasse der Schule. Nach der vierten Klasse sollten die Kinder in die Talmud Tora Schule oder die jüdische Mädchenschule wechseln. Etliche, wie Peter Perls, gehörten zur christlichen Konfession. Im März 1940 wurde Peter in der "Volks- und Oberschule für Juden" – die Talmud Tora Schule gab es nicht mehr – angemeldet mit dem Vermerk "geeignet für Klasse G 3". Er besuchte diese Schule bis zum Sommer 1942, als sie geschlossen wurde. Sein Abgangszeugnis Nr. 997 vom 30. Juni 1942, das ihn als Schüler der Klasse G 4 auswies, enthielt nur gute Noten. Im Kommentar hieß es: "Peter hat die Klasse mit Erfolg besucht und die Reife der Klasse 1 einer höheren Lehranstalt erreicht." Aber nach dem erzwungenen Abgang von der Schule gab es für Peter keinen schulischen Lernort mehr. Bis zu seiner Deportation ein Jahr später durfte er keine höhere Schule besuchen.
Während seiner Schulzeit wurde Peter Opfer von Diskriminierungen. Seine Großmutter versuchte, ihm sein Schicksal zu erleichtern und holte ihn immer von der Schule ab, damit er nicht schutzlos den weiten Weg antreten musste. Inzwischen hatte der Vater verzweifelte Anstrengungen unternommen, ihn nach Palästina nachkommen zu lassen. Als das infolge des Kriegsbeginns nicht gelang, obwohl er sämtliche Papiere zusammen hatte, suchte er nach einer Möglichkeit, Peter in die USA ausreisen zu lassen. Aber auch das schlug fehl.
Der Großvater Hugo Goldmann arbeitete in Hamburg als Handelsvertreter für Tabakwaren. Die Firma war 1901 gegründet worden. 1937 schied Hugo Goldmann aus der Firma aus, weil er Jude war. Sein Sohn Georg war Mitinhaber, und die "arische" Mutter wurde Teilhaberin. Wahrscheinlich bis Oktober 1936 hatte die Familie noch in der Wiesenstraße 27 gewohnt und war dann in den ersten Stock des Hauses Weidenstieg 8 gezogen. 1943 wurde das Haus Weidenstieg 8 bei einem Bombenangriff beschädigt. Danach beschlagnahmte die Gestapo die Wohnung bis auf ein Zimmer, das der Familie Goldmann blieb.
Peter Perls wurde am 23. Juni 1943 nach Theresienstadt deportiert. Dort lebte er im Block Q 609, wo noch andere unbegleitete Waisenkinder untergebracht waren. Die Straßen in Theresienstadt waren alle nach Q und L benannt, in Verbindung mit einer Zahl. Es handelte sich um ein altes zweistöckiges Gebäude, in dem eine große Gruppe Kinder in drangvoller Enge jeweils ein Zimmer bewohnte. Die Kinder schliefen in dreistöckigen Betten. Verbunden mit der Enge war eine Ungezieferplage, Flöhe und Wanzen. In dem Haus lebten deutsche und tschechische Kinder, die Gruppen – jedes Zimmer war ein eigenes "Lager" – waren nicht national gemischt, und deutsche und tschechische Kinder wurden gegeneinander aufgehetzt. Geleitet wurde das Haus von Beppo Krämer, der eigentlich Jirka Krämer hieß und Tscheche war. Seine Stellvertreterin war Else Timendorfer, eine Erzieherin aus Berlin.
Einige Kinder aus Norddeutschland freundeten sich miteinander an. Ein Leidensgenosse von Peter Perls, Gerhard Lilienfeldt, der als Zehnjähriger mit seinem fünfjährigen Bruder in Theresienstadt war, überlebte. Dieser 2009 verstorbene Zeitzeuge stiftete die Stolpersteine für Peter Perls sowie für die Geschwister Irmgard und Arnold Löwenthal aus der Angerstraße. Er erinnerte sich, dass Peter ein sehr reifes und kluges Kind war. Bei den Kameraden hieß er "der zerstreute Professor". Beide Jungen waren protestantisch getauft und besuchten in Theresienstadt einmal einen protestantischen Gottesdienst. Die Protestanten in Theresienstadt konnten den Kindern nicht helfen.
1944 sollte eine Delegation des Internationalen Roten Kreuzes das Getto besuchen. Deshalb fand eine "Verschönerungsaktion" statt. Es wurden Blumen gepflanzt und Häuser gestrichen. Peter Perls und einige andere Kinder gestalteten im Rahmen dieser "Verschönerungsaktion" ein Album als Geburtstagsgeschenk für den Leiter ihres Kinderheims Beppo Krämer. Für dieses Album verfasste Peter Perls Reime. Das Album ist erhalten. Es wurde zurückgelassen, als die meisten Kinder und auch Beppo Krämer nach Auschwitz gebracht wurden. Gerhard Lilienfeldt, der zurückgestellt worden war, nahm das Album an sich und rettete es. Viele Jahre später übergab er es dem Theresienstädter Museum.
Peter Perls wurde am 23. Oktober 1944 nach Auschwitz gebracht und ermordet, er war 13 Jahre alt.
Der Großvater Hugo Goldmann starb im Oktober 1943, die Großmutter im Januar 1945. Wochen nach dem Tod von Hugo Goldmann kam ein Schreiben mit dem Deportationsbefehl. Die Familie ging mit dem Schreiben zur Behörde, um den Fehler zu melden. Hugo und Auguste Goldmanns Sohn Georg wurde als "Mischling ersten Grades" nicht deportiert. Er musste aber Zwangsarbeit leisten und war 1944 in einem Zwangsarbeiterlager in Frankreich interniert. Nach dem Krieg kehrte er nach Hamburg zurück.
© Susanne Lohmeyer
Quellen: 1; 4; 5; 8; StaH 332-5 Standesämter, 8808 + 175/1926; StaH 351-11 AfW, 171005 (Hugo Goldmann); StaH 361-2 II Oberschulbehörde (OSB) II, B192 Nr. 1 Schule allgemein; StaH 362-6/10 Talmud Tora Schule StaH 741-4 Fotoarchiv Sa 1248; Maajan Nr. 76, 2005, S. 2631–2633; Mitgliedskarte der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig; BArch, Liste der jüdischen Einwohner im Deutschen Reich 1933–1945; BArch, R1509, Ergänzungskarten für Angaben über Abstammung (Volkszählung v. 17.5.1939) Wohnortliste Hamburg; FZH/WdE Interview mit Prof. Hermann Degwitz am 15.6.1993 von Alfons Kenkmann; Auskunft Stadtverwaltung Schkeuditz vom 19.8.2010; Auskünfte von Margit Goldmann 2010; Auskünfte von Yuvall Pniell 2008; Auskünfte Stadtverwaltung Schkeuditz; Auskünfte Jüdische Gemeinde Leipzig 2008; HAB II 1939; Beate Meyer, "Jüdische Mischlinge", S. 333ff.; H. G. Adler, Theresienstadt 1941–1945, S. 547ff.; Ärzte und Zahnärzte in Sachsen 1933–1945, S. 237f.
Zur Nummerierung häufig genutzter Quellen siehe Link "Recherche und Quellen".