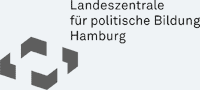Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Conrad Kaiser * 1892
Eichenstraße 59 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
HIER WOHNTE
CONRAD KAISER
JG. 1892
VERHAFTET
"VORBEREITUNG ZUM HOCHVERRAT"
1944 NEUENGAMME
ERTRUNKEN 3.5.1945
CAP ARCONA
Conrad Kaiser, geb. 25.11.1892 in Honigfelde/Westpreußen, am 29.12.1943 verhaftet wegen "Vorbereitung zum Hochverrat", vom KZ Neuengamme auf die Cap Arcona gebracht, vermutlich am 3.5.1945 ertrunken
Eichenstraße 59
Der gelernte Tischler Conrad Kruczynski hatte vier Geschwister. Seine Eltern, der Landwirt Franz Dominik Kruczynski (geb. 29.1.1860) und seine Frau Rosalia, geb. Grochowska, hatten am 4. Mai 1883 in Straszewo/Westpreussen geheiratet. Über seine Kindheit und Jugendzeit ist uns nichts bekannt. Er soll als Soldat einer M.G. (Maschinengewehr) Kompanie bis 1918 den Ersten Weltkrieg mitgemacht haben. In den Dokumenten wurde er als "glaubenslos" bezeichnet.
Conrad Kruczynski änderte seinen Namen mit Genehmigung des Regierungspräsidenten zu Marienwerder vom 1. Juli 1918 an auf den Namen Kaiser. Wann er genau nach Hamburg kam, ist nicht bekannt.
Am 5. Januar 1924 heiratete er in Hamburg seine erste Ehefrau Anna Frieda, geb. Bastian. Vermutlich wohnte er zu dieser Zeit zur Untermiete. Am 25. September 1924 kam das erste Kind aus dieser Ehe, Rolf Kaiser, auf die Welt. Die Familie lebte, lt. Meldekarte seit 1928, zur Untermiete in der Großen Freiheit 86. Die Ehe wurde jedoch am 28. März 1933 geschieden. Im Scheidungsverfahren warfen sich die Eheleute gegenseitig Ehebruch vor, so dass beide schuldig geschieden wurden. Frieda Kaiser blieb nach der Scheidung in der Wohnung und betrieb dort einen Frisiersalon.
Ab 1933 wohnte Conrad Kaiser in der Kleinen Freiheit 16, wo er von 1935 bis 1939 ein Lebensmittelgeschäft (Feinkost) betrieb, das in einem Firmenschild auch als "Fettwarengroßhandel" bezeichnet wurde. Unter dem Geschäft soll sich ein Wohnkeller befunden haben.
Conrad Kaiser wurde - dokumentiert seit 1921 - wegen mehrerer Straftaten belangt. In einem Strafregisterauszug waren insgesamt 16 Delikte, darunter Diebstahl, Betrug, Gewerbevergehen, Körperverletzung und Beihilfe zur Steuerhehlerei aufgeführt, für die er zu Geldstrafen oder kurzen Haftstrafen verurteilt worden war.
In einem Verfahren aus dem Jahre 1934, das gegen ihn und vier weitere Angeklagte eingeleitet worden war, erhielt er als Mittäter für "Beihilfe zur gewinnsüchtigen Steuerhehlerei" eine Gefängnisstrafe von einem Monat: Sein Geschäft in der Kleinen Freiheit sollte als Umschlagplatz für unversteuerte Tabakwaren und Zigarettenpapier aus Holland und Belgien mitbenutzt worden sein.
Am 16. April 1937 verurteilte die große Strafkammer 1 Altona Conrad Kaiser wegen "Rassenschande" zu 1 ½ Jahren Zuchthaus. Ein anonymer Denunziant hatte den Behörden angezeigt, dass Conrad Kaiser eine Beziehung zu der Stenotypistin Rosa Garcia (geb. am 29.10.1906 in Hamburg) unterhielt. Rosa Garcia wohnte in der Wrangelstraße 10 und war Jüdin. Aus der Beziehung ging ein Sohn hervor, Konrad Garcia, geb. am 6.10.1936. (Rosa Garcia und der fünfjährige Konrad wurden am 6.12.1941 nach Riga deportiert, siehe www.stolpersteine-hamburg.de. In der Wrangelstraße 10 erinnern Stolpersteine an beide)
Aufgrund der Denunziation wurde Kaiser am 1. November 1936 in das Gerichtsgefängnis Altona eingeliefert, am 25. Februar 1937 ins Zuchthaus Hamburg und am 16. März 1937 in das KZ Börgermoor überführt. Das Konzentrationslager Börgermoor gehörte zu den sogenannten Emslandlagern und diente ab 1934 auch als Strafgefangenenlager. Am 6. Mai 1938 wurde Conrad Kaiser dort entlassen.
Parallel zu der Beziehung zu Rosa Garcia war Kaiser mit Marie Christine Gerken liiert, die offiziell als seine Verlobte galt. Sie war am 10.8.1906 in Helvesiek, Kreis Rothenburg in Niedersachsen, geboren worden. Ihre Eltern Johann Gerken, geb. 13.4.1868, und Anna Maria Katharina, geb. Behrens, geb. 31.7.1878, besaßen einen landwirtschaftlichen Betrieb in Scheeßel. Marie Gerken hatte nach der Schulentlassung auf dem Hof ihrer Eltern geholfen und dann in Bremen im Haushalt gearbeitet. Als sie 25 Jahre alt war, zahlten ihre Eltern ihr das Erbteil aus. Seit 1934 hielt sie sich zunächst als Fabrikarbeiterin in Hamburg auf. Dokumentiert ist, dass sie auch in Conrad Kaisers Geschäft tätig war, den sie als Kundin kennengelernt hatte.
Beide kamen sich näher. Aus der Verbindung stammte der zweite Sohn Conrads, der am 19.10.1936 zur Welt kam und ebenfalls den Namen Konrad erhielt. Im Oktober 1936 wurden also zwei Söhne aus verschiedenen Beziehungen mit dem gleichen Vornamen geboren. Konrad wurde von der Großmutter mütterlicherseits mit betreut. Marie Gerken und ihre inzwischen verwitwete Mutter lebten zu der Zeit in der Dreyerstraße 4. Den Hof in Scheeßel führte der Sohn bzw. Bruder weiter, so dass Maries Mutter ihr Altenteil in Hamburg verbringen konnte.
Marie Gerken reichte ein Gnadengesuch mit der Begründung ein, dass das Feinkostgeschäft während Conrad Kaisers Haftzeit weiter betrieben werden musste. Sie bat erfolglos um seine Freilassung, damit er im Geschäft tätig sein und auch für seinen Sohn sorgen könne. Vermutlich führte Marie Gerken, unterstützt durch ihre Mutter, das Geschäft in dieser Zeit weiter.
Nach Conrad Kaisers Haftentlassung heirateten er und Marie Gerken. Ab Mai 1938 führte er sein Geschäft weiter, bis er im Dezember des Jahres erneut verurteilt wurde, diesmal wegen Verstoßes gegen das Lebensmittelgesetz. Damit verbunden war, dass ihm die Führung eines Betriebes, in dem es um die Herstellung und den Vertrieb von Lebensmitteln ging, untersagt wurde. Damit verlor die Familie ihre Existenzgrundlage und Conrad suchte nun andere Erwerbsmöglichkeiten. Überliefert sind z.B. die Berufsbezeichnungen Kellner, Toilettenwärter, Garderobenarbeiter und Wirtschaftsgehilfe. So soll er zeitweise im Bierhaus Astra am Steindamm der Pächter der Toiletten gewesen sein. Als Anschrift galt bis 1939 die Kleine Freiheit 16 in Altona, die frühere Geschäftsadresse.
Danach wechselte die Familie häufig ihren Wohnsitz: ab 15. Februar 1939 lautete er Dreyerstraße 4, ab 25. Oktober 1939 Paulinenstrasse 15, 1940 bis 1942 Eduardstraße 47, ab 1942 Eichenstraße 59, 1943 Eidelstedter Weg 24. Das Ehepaar besaß ein Grundstück in der Silbersackstraße, das mit Mitteln aus Maries Erbe gekauft worden war. Dort sollte ein Geschäft entstehen, was die Kriegsereignisse verhinderten. Auch das Haus Eichenstraße 59 (wo der Stolperstein an Conrad Kaiser erinnert) befand sich – ebenso wie das Haus Eduardstr. 47 - im Besitz der Familie Kaiser. Das Haus in der Eichenstraße wurde – siehe unten - durch Bombenangriffe 1943 vollständig zerstört.
Inmitten der Kriegsereignisse wurde die Familie größer: Am 23.4.1940 kam die Tochter Rosalind Kaiser zur Welt und am 19.3.1943 folgte der Sohn Horst Kaiser.
Conrad Kaiser wurde am 29. Dezember 1943 von der Gestapo verhaftet und am 3. Juni 1944 in das KZ Neuengamme eingeliefert. In den Unterlagen der "Vereinigten Arbeitsgemeinschaft der Naziverfolgung (VVN)" wird als Grund der Inhaftierung "Vorbereitung zum Hochverrat" genannt. Im KZ Neuengamme wurde Conrad Kaiser mit der Haftnummer 27013, zunächst im Block 11 und 27, dann im Block 24 als Häftling mit KPD-Mitgliedschaft geführt.
Zu seinem Todesdatum existieren widersprechende Aussagen: Laut Totenliste der Hamburger Widerstandskämpfer und Verfolgten soll er am 14. Dezember 1944 im KZ Neuengamme ums Leben gekommen sein. Anderslautende Dokumente beinhalten jedoch, dass er zusammen mit anderen Häftlingen Ende April von Neuengamme auf die Schiffe "Cap Arcona" oder "Thielbek" in die Lübecker Bucht abtransportiert worden sein soll. Dort kamen bei britischen Angriffen auf die Schiffe am 3.5.1945 fast alle dorthin verlegten KZ-Häftlinge ums Leben.
Conrad Kaisers Witwe soll noch am 11. März 1945 einen Brief von ihrem Mann aus dem KZ Neuengamme erhalten haben, was für die Version spricht, dass dieser ertrunken ist.
Vor Conrad Kaisers Verhaftung lebte die Familie mit den drei Kindern in der Eichenstraße 59, wo sie im Sommer 1943 nach einem Bombenangriff wohnungslos wurden. Sie kamen zunächst in einer Baracke in der Straße Am Weiher und dann bis November 1943 in einem Ruinenkeller in derselben Straße unter. Danach lebten sie zunächst im Eidelstedter Weg 29, bis sie im Dezember 1945 in die Alardusstraße 4 umziehen konnten, wo auch Marie Kaisers Mutter, Anna Gerken, bis zu ihrem Tod mit lebte. Im Juli 1958 zog die Familie dann in ein zweistöckiges Wohnhaus in der Wrangelstraße 47. Marie Kaiser hatte es aus Lastenausgleichsmitteln zusammen mit ihrem Sohn Konrad gekauft. Konrad Kaiser junior hatte eine Lehre als Klempner- und Installateur absolviert und führte einen Betrieb als selbstständiger Klempner Kieler Straße.
Nach dem Krieg wurde Marie Kaiser als Alleinerbin anerkannt, erhielt Witwen- und Waisenrente für sich und die drei Kinder. Da die Familie bei den Luftangriffen 1943 alle Habe verloren hatte, musste sie mehrmals Anträge auf Möbel und Hilfen für die Kinder stellen.
Unterstützung erhielt die Witwe vom "Komitee politischer Gefangener", das sowohl Hilfe bei den Nachforschungen nach dem Verbleib des Ehemannes wie auch der Suche nach einer neuen Wohnung und der Beantragung von Wiedergutmachungszahlungen leistete. Marie Kaiser hatte zunächst über den Such- und Meldedienst nach ihm geforscht. Dieser stellte am 22. Mai 1946 fest, "daß Kaiser vom KZ Neuengamme aus mit 10000 weiteren Häftlingen nach Lübeck und von dort auf die Cap Arcona oder Thielbek geschleppt wurde. Da Kaiser nicht unter den Geretteten festgestellt wurde und auch sonst nicht ermittelt werden konnte, dürfte sicher sein, dass er zu den 7600 Opfern der Katastrophe vom 3.5.1945 zählte." Am 6. Juni 1946 wurde Conrad Kaiser vom Amtsgericht Hamburg für tot erklärt.
Auf ihren Antrag auf Wiedergutmachungszahlungen wegen politischer Verfolgung erhielt Marie Kaiser zunächst eine Sonderhilfsrente. Jedoch kam es zu jahrelangen Auseinandersetzungen mit dem Wiedergutmachungsamt, weil dieses anzweifelte, dass Conrad zu den politisch Verfolgten zählte, wofür kaum Hinweise existierten. Das Amt für Wiedergutmachung stellte umfangreiche Nachforschungen an, auf welcher Grundlage die Verhaftung 1943 erfolgt war. Es wurde u.a. ein überlebender Häftling als Zeuge angehört, der aussagte, dass Kaiser den "roten Winkel" getragen habe, also das Abzeichen auf der Häftlingskleidung für politisch Verfolgte. Dieser Zeuge erinnerte sich auch daran, dass Kaiser ihm gesagt habe, er sei wegen des Abhörens ausländischer Sender verhaftet worden. Diese Aussage, zusammen mit der Vermutung der Ehefrau, dass Kaiser von Alfons Pannek, einem Gestapospitzel, denunziert worden sei, wirft ein anderes Licht auf die Verhaftung, denn Pannek hatte, als "Lesebote"(Zeitungsausträger) getarnt, der Gestapo viele Familien ausgeliefert.
Bis 1962 konnte Marie Kaiser jedoch keine konkreten Nachweise über politische Aktivitäten erbringen, sodass Conrad Kaiser als mutmaßlich strafrechtlich Verfolgter galt und weitere Wiedergutmachungszahlungen ausblieben. Marie Kaiser wurde jedoch aufgrund der 18-monatigen Haft ihres Mannes wegen "Rassenschande" eine Haftentschädigungszahlung nach dem Bundesentschädigungsgesetz zugebilligt, die Conrad Kaiser zugestanden hätten und an sie vererbbar waren.
Bis zu ihrem Tod am 20. Juli 1996 lebte Marie Kaiser zusammen mit ihrem Sohn Konrad und dessen Ehefrau Margrit in Hamburg. Konrad starb 2009, seine Schwester Rosalind 2008. Horst Kaiser, das dritte Kind, lebt in Südafrika.
Stand: Oktober 2020
© Ursula Mühler
Quellen: StaH 213-9_104; StaH 213-11_30736; StaH 213-11_50738; StaH 241-1_2849; StaH 351-11_30851; StaH 351-11_30856; StaH 324-1_K 5082.xls; StaH 351-11_30857; StaH 351-11_32720 und 32721; div. Hamburger Adressbücher und Meldekarteien; KZ-Gedenkstätte Neuengamme: WVHA Karteikarten und FGN Hans-Schwarz-Nachlass; Totenliste Hamburger Widerstandskämpfer und Verfolgter 1933-1945; Arolsen Archiv, Reference services; VVN-BdA Hamburg; Kreisarchiv Landkreis Rotenburg/Wümme, Geburtenregister; Westpreußisches Ortsverzeichnis Familienforschung; Klaus Bästlein: "Hitlers Niederlage ist nicht unsere Niederlage, sondern unser Sieg!" Die Bästlein-Organisation. Zum Widerstand aus der Arbeiterbewegung in Hamburg und Nordwestdeutschland während des Krieges (1939-1945), in: Beate Meyer/Joachim Szodrzynski (Hrsg.): Vom Zweifeln und Weitermachen. Fragmente der Hamburger KPD-Geschichte. Hamburg 1988, S. 44ff.; Stefan Buchen: Die neuen Akten des Gestapo-Verräters. Taz, 15.9.2019; Gespräch mit Angehörigen: Margrit Kaiser und Caroline Kaiser, div. Daten.