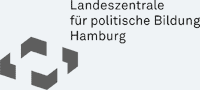Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Gustav Mehrgut * 1889
Kippingstraße 2 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
HIER WOHNTE
GUSTAV MEHRGUT
JG. 1889
VERHAFTET 1941
ZUCHTHAUS BÜTZOW
DEPORTIERT
AUSCHWITZ
ERMORDET 3.2.1943
Gustav Mehrgut, geb. am 10.10.1889 in Gelnhausen, 1941 verhaftet, Zuchthaus Bremen-Oslebshausen, Zuchthaus Bützow, deportiert nach Auschwitz am 7.1.1943, dort ermordet am 3.2.1943
Kippingstraße 2
Gustav Mehrgut (in den Akten findet sich auch die Schreibweise Mehrguth) war vermutlich das "schwarze Schaf" seiner Familie. 1921 wurde er erstmals aktenkundig. Am 17. März 1941 verurteilte ihn das Hanseatische Sondergericht in Hamburg als "Volksschädling" zu acht Jahren Haft. Als in "privilegierter Mischehe" lebender Jude hätte Gustav Mehrgut vielleicht eine Chance gehabt, der Ermordung aus "rassischen" Gründen zu entgehen, als verurteilter "Volksschädling" jedoch kaum. Die Gestapo ordnete im Oktober 1940 schriftlich an, dass auch nach der Strafverbüßung die "Schutzhaft" fortgesetzt werden solle. 1942 verfügte ein Erlass Heinrich Himmlers die "Verlegung" aller jüdischen Häftlinge aus Gefängnissen und Zuchthäusern nach Auschwitz, eine Maßnahme, die auch Gustav Mehrgut betraf. Im Januar 1943 starb er dort, offiziell an "Herzmuskeldegeneration".
Gustav Mehrgut war gebürtig aus Gelnhausen in Hessen, wuchs aber in Hamburg auf. Seine Eltern waren der Weinhändler Meyer Mehrgut (geb. 1855) und Rosa Mehrgut, geb. Aronstein. 1885 lebten in Gelnhausen 225 Juden, 6,1 Prozent von 3694 Einwohnern. Von 1821 bis 1974 war Gelnhausen Sitz der Verwaltung des gleichnamigen Landkreises. Seit 2006 ist der Ort Sitz der Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises und damit wieder Kreisstadt.
Gustav Mehrguts Eltern waren 1890 nach Hamburg gezogen. Im Juli 1887 wurde die Firma M. Mehrgut & Co. gegründet mit Markus Mehrgut und Meyer Mehrgut aus Gelnhausen als Gesellschafter. Die Weinhandlung M. Mehrguth & Co hatte ihre Geschäftsräume am Pferdemarkt 14 – heute Gerhard-Hauptmann-Platz –, die Wohnung befand sich Anfang der 1890er Jahre in der Paulstraße 14, später in der Rappstraße 12 im Grindel und ungefähr ab 1910 in der Werderstraße 4. Der Vater starb im Dezember 1925 in Hamburg, die Mutter vermutlich 1930. Meyer Mehrgut wurde auf dem Jüdischen Friedhof an der Ilandkoppel begraben. Auf dem Jüdischen Friedhof in Bremen-Hastedt gibt es einen Grabstein für Rosa Mehrguth, geb. 1855, gest. 1930, vermutlich Gustavs Mutter.
Gustav Mehrgut besuchte in Hamburg zunächst die Vorschulklassen der Realschule am Weidenstieg und wurde dann für zweieinhalb Jahre auf ein Internat in Seesen im Harz geschickt. Vermutlich handelte es sich um die 1801 von Israel Jacobson gegründete "Religions- und Industrieschule", deren Wurzeln im aufgeklärten Judentum lagen und die ab 1805 auch christliche Schüler aufnahm. Um 1900 hatte die Schule etwa 300 Schüler, von denen etwa die Hälfte im Internat lebte. Von 1901 bis 1904 besuchte Gustav Mehrgut dann die Wahnschaff-Schule in Hamburg-Rotherbaum, die er aus der Sekunda verließ. Anschließend absolvierte er von 1905 bis 1908 eine kaufmännische Lehre in einer Trikotagen- und Strumpfwarenhandlung en gros. Danach war er ein Jahr als Volontär bei der Fa. Gebr. Alsberg tätig, einem Warenhaus am Großen Burstah. Zwischen 1910 und 1925 betätigte er sich mit Unterbrechungen in der Weinhandlung seiner Familie. Der Vater schied 1924 aus der Firma aus, die dann von einem Onkel, Isaak Oppenheim, übernommen und 1928 liquidiert wurde. Am Ersten Weltkrieg nahm Gustav Mehrgut nicht teil, wahrscheinlich wegen gesundheitlicher Probleme mit seinen Füßen.
Vermutlich Anfang der 1920er Jahre heiratete Gustav Mehrgut Franziska Willms (geb. 25.5.1892 in Füssen), eine nichtjüdische Katholikin, mit der er die 1923 geborene Tochter Rose Marie hatte. Die Ehe wurde geschieden, weil Gustav Mehrgut gegen seine Frau gewalttätig geworden war. Nach der Scheidung wohnte er zunächst weiterhin in der Wohnung seiner Frau in der Schäferstraße 14, bis diese eine Räumungsklage erwirkte. 1927 platzte eine Verlobung, weil er seine Freundin betrogen hatte. 1931 heiratete er dann erneut. Seine zweite Frau war Anna Hedwig, geb. Krause (geb. 1902 in Zoppot), auch sie war nichtjüdisch und katholisch. Das Ehepaar bekam zwei Kinder: Werner (geb. 1931) und Ruth Uta (geb. 1938). Beide Kinder kamen wegen ihrer Füße in "Krüppelfürsorge". Wie ihr Vater wurden die Kinder evangelisch getauft. Gustav Mehrgut hatte sich nämlich im Juni 1938 in der Jerusalemkirche taufen lassen und war deren Mitglied geworden. Er lebte in "privilegierter Mischehe". Auf der Kultussteuerkarteikarte der Jüdischen Gemeinde, die seit 1931 geführt wurde, wurde später eingetragen "Freiwilliges Mitglied der Reichsvereinigung", d. h., aufgrund seiner "privilegierten Mischehe" war er nicht zur Mitgliedschaft in der Reichsvereinigung verpflichtet.
In der Kippingstraße, Ecke Kielortallee wohnte die Familie vermutlich nur für kurze Zeit. Später zog sie in die Weidestraße 111, in den Luruper Weg 21 und zuletzt in den Pinnasweg 5 in Altona, die Adresse, wo Gustav Mehrgut verhaftet wurde.
Seit Mitte der 1920er Jahre bezog Gustav Mehrgut immer wieder Wohlfahrtsunterstützung. Sein Vater weigerte sich, ihn weiter zu unterstützen, und die Familie zeigte ihn sogar wegen versuchter Erpressung an. Er verwendete große Energie darauf, schriftlich immer wieder Forderungen nach finanzieller Unterstützung zu stellen. Auch drohte er mit Selbsttötung und Zeitungsveröffentlichungen für den Fall, dass ihm keine Hilfe gewährt würde. Im April 1928 unternahm er tatsächlich einen Selbsttötungsversuch mit Veronal, und im Mai veröffentlichte die Hamburger Volkszeitung einen Artikel zu seinem Fall unter der Überschrift "Tragödie eines Mittelständlers". Mehrfach versuchte ihn die Behörde im Versorgungsheim Farmsen unterzubringen, was er ablehnte und zu verhindern wusste. Offenbar gelang es ihm immer wieder, Leistungen zu erhalten.
Ebenfalls ab Mitte der 1920er Jahre beschäftigte er sich mit Okkultismus und entsprechenden medizinischen Behandlungsmethoden wie Heil-Magnetismus, Augendiagnose und Handliniendeutung. Vielleicht sah er hier eine Erwerbsquelle für sich. Kenntnisse eignete er sich vermutlich im Selbststudium an, jedenfalls besorgte er sich entsprechende Bücher. 1927 erhielt er vom Gesundheitsamt die Erlaubnis, als Krankenbehandler zu arbeiten, bekam einen Gewerbeschein und betrieb zeitweise eine "Praxis" in der Weidestraße 111, später Beim Spritzenhause 2 in St. Pauli und zuletzt am Pinnasweg. Zudem beschäftigte er sich mit Horoskopen und Pendeln. Eine seiner "Geschäftsideen" war es Ende der 1930er Jahre, "Schutzbriefe" auszustellen, das waren Amulette, die Menschen bzw. deren Angehörige beschützen sollten. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gelang es ihm, diese vor allem Frauen von Soldaten aufzuschwatzen. Dass seine Geschäfte als Heilpraktiker gut dokumentiert sind, verdankt sich einem Prozess wegen Erschleichens von Wohlfahrtsunterstützung und Erwerbslosenunterstützung. Seine Einkünfte als Heilpraktiker hatte er stets verschwiegen. Das Gericht hielt ihm die Leichtgläubigkeit seiner Patienten zugute. Im März 1941 schrieb Oberstaatsanwalt Marwege an den für das Sondergericht zuständigen Generalstaatsanwalt, er beabsichtige, eine Zuchthausstrafe von fünf bis acht Jahren zu beantragen. Eine wesentlich höhere Strafe, die wegen des Vorlebens möglich gewesen wäre, lehnte er mit der Begründung ab, die Geschädigten seien ihrem Aberglauben bereitwillig gefolgt.
Gustav Mehrguts Vorstrafen datierten aus den Jahren 1921, 1925, 1928 und 1932, vor allem wegen Unterschlagung. 1938 erhielt er als Jude ein Berufsverbot, das er nicht beachtete. Außerdem hatte er auf Visitenkarten, mit denen er für sich warb, seinen Zwangsnamen Israel nicht angegeben. Am 19. September 1940 kam er in "Schutzhaft". Zu der Zeit war er als Erdarbeiter bei der Fa. Blöcker am Holstenplatz 14 tätig, wie schon vorher bei anderen Firmen. In einem Verhör gab er im September 1940 an, er beabsichtige, mit Frau und Kindern nach Amerika auszuwandern, wo sich schon Geschwister seiner Ehefrau aufhielten. Am 17. März 1941 wurde Gustav Mehrgut dann vom Sondergericht verurteilt, am 29. März ins Gefängnis Hütten gebracht, um von dort ins Zuchthaus Bremen-Oslebshausen transportiert zu werden. Am 7. Januar 1943 wurde er von der Strafanstalt Bützow Dreibergen der Gestapo in Schwerin übergeben, die ihn nach Auschwitz deportieren ließ.
Über das Schicksal seiner Ehefrau und seiner drei Kinder ist uns nichts bekannt.
© Susanne Lohmeyer
Quellen: 1; 4; 5; StaH 213-11, 4062/41; StaH 231-3 A 13 Bd 10 lfd Nr. 24790; Stah 231-7 A 2 Bd 21 lfd Nr. 5525; StaH 242-1II Gefängnisverwaltung II Ablieferung 16 Untersuchungshaftkartei Männer; StaH 332-5 Standesämter, 8082 + 601/1925; StaH 332-5, 13294 + 448/1930; HAB II 1892, 1900; 1910; 1926; 1937; Harald Jenner, 150 Jahre; Daniel Hanke, Die Geschichte der Juden in Gelnhausen; Ingo Wille, Das Versorgungsheim Farmsen. http://www.hfjs.eu/imperia/md/content/vorlesungsverzeichnissehfjs/sonstige/ seesenbestand.pdf.
Zur Nummerierung häufig genutzter Quellen siehe Link "Recherche und Quellen".