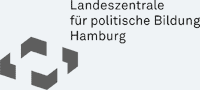Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Jacob (Jakob) Ries * 1876
Lindenallee 44 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
HIER WOHNTE
JACOB RIES
JG. 1876
DEPORTIERT 1942
THERESIENSTADT
TOT 9.4.1943
Weitere Stolpersteine in Lindenallee 44:
Emanuel Kaletta
Jakob Ries, geb. am 5.6.1876 in Gailingen, deportiert am 20.8.1942 von Stuttgart aus nach Theresienstadt, dort gestorben am 9.4.1943
Lindenallee 44
Der kleine Ort Gailingen, aus dem Jakob Ries stammte, liegt in der Nähe von Konstanz am Hochrhein. Dort gab es zur Zeit seiner Geburt eine blühende Jüdische Gemeinde: 41 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner waren jüdischen Glaubens, darunter auch der Bürgermeister. Die Schulkinder wurden unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit in gemeinsamen Schulräumen unterrichtet.
Jakob Ries’ Eltern, der Gailinger Abraham Ries und dessen Frau Rosina "Rosa", geborene Schnurmann, hatten 1874 in Offenburg geheiratet. Abraham Ries war laut den Gailinger Standesbüchern Handelsmann – eine Berufsbezeichnung, die damals meist Viehhändler bedeutete. Seine Braut stammte aus Schmieheim bei Freiburg, nach der Hochzeit lebte das Ehepaar in Gailingen. Dort wurden auch die vier Kinder geboren: Der älteste Sohn Elias kam 1875 zur Welt, ihm folgten rund ein Jahr später Jakob, weitere zwei Jahre später Jette und 1880 die Jüngste der Familie, Lina.
Jakobs Geschwister Elias und Jette heirateten in die nahe Schweiz, wo sie fortan lebten. Lina Ries feierte 1913 ihre Hochzeit mit Max Kaufmann noch in Gailingen, anschließend zogen beide nach Mannheim. Auch Jakob Ries verließ seinen Geburtsort. Er legte die weiteste Strecke zurück, denn ihn zog es in den Norden, nach Hamburg. Wann er dort ankam, ist nicht bekannt; ebenso wenig, ob er zu der Zeit bereits seine Schlachterlehre abgeschlossen hatte. Sicher ist, dass er im Ersten Weltkrieg als Soldat eingezogen und verwundet wurde.
Im November 1915 heiratete er in der Hansestadt die fast gleichaltrige Verkäuferin Therese Zimak, alias Freybuschewitz, aus Gilgenburg in Ostpreußen. Sie war zusammen mit ihrer Mutter Julie und den Geschwistern Bertha und Leopold nach dem Tod des Vaters 1907 an die Elbe gekommen (siehe "Stolpersteine in Hamburg-Rothenburgsort", Wilhelm Adler, Bertha Wartelski, geb. Zimak, und Louis Wartelski).
Nach der Hochzeit bewohnten Jakob und Therese Ries Thereses bisherige Wohnung in der Lindenallee 44. Im Souterrain des Hauses eröffnete Jakob Ries zunächst eine eigene Schlachterei, spezialisierte sich dann aber als Trichinenbeschauer. Er untersuchte Fleisch, das für den Verzehr durch Menschen vorgesehen war, auf gesundheitsschädliche Würmer.
Jakob und Therese Ries’ Ehe dauerte zwölf Jahre. Am 1.4.1927 starb Therese, 51-jährig, im Israelitischen Krankenhaus, die Todesursache ist unbekannt. Gemeinsame Kinder gab es nicht. Jakob Ries blieb die nächsten Jahre noch in Hamburg, aufgrund seiner Kriegsbeschädigung konnte er ab Mitte 1934 nicht mehr arbeiten. Da war er 60 Jahre alt. Acht Monate später verließ er Hamburg und zog nach Mannheim, wo nach wie vor seine jüngste Schwester Lina mit ihrem Mann Max Kaufmann lebte. Am 22. Oktober 1940 verschleppten die Gestapo und französische Behörden im Rahmen der ersten Deportation von Jüdinnen und Juden aus Deutschland – der "Wagner-Bürkel-Aktion" – rund 6.500 Deutsche jüdischen Glaubens aus Baden, der Pfalz und dem Saarland ins südfranzösische Internierungslager Gurs, darunter auch Lina und Max Kaufmann. Beide wurden am 10. August 1942 über das Durchgangs- und Sammellager Drancy bei Paris mit Transport Nr. 1006 nach Auschwitz verbracht und vermutlich gleich nach der Ankunft ermordet.
Auch Jakob Ries war für diese Deportation vorgesehen. So trug seine Mannheimer Meldekarte den Stempel "am 22.10.40 nach Judeninternierungslager Frankreich abgeschoben". Offenbar war er aber nicht transportfähig, denn einen Tag später findet sich ein Hinweis auf das Israelitische Krankenhaus in Mannheim. Fast zwei Jahre später, am 20. August 1942 wurde er mit dem Transport XIII/1, Zug Da 505, von Stuttgart aus nach Theresienstadt deportiert, wo er acht Monate später, im Alter von 66 Jahren, starb. Wann und warum er nach Stuttgart kam, ließ sich nicht klären. Auf dem Mannheimer Mahnmal für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus ist sein Name ebenso verzeichnet wie der seiner Schwester Lina und seines Schwagers Max Kaufmann.
© Frauke Steinhäuser
Quellen: 1; 4; 5; 8; StaH 332-5 Standesämter, 8707 u. 443/1915 sowie 8089 u. 210/1927; StaH 522-1 Wählerverzeichnis 1930; StaH 522-1 Jüdische Gemeinden, 390 Wählerliste 1930; www.in-gailingen.de (Zugriff 17.2.2012); telefonische und E-Mail-Auskünfte sowie Auszüge aus der Ende 1935/1936 in Gailingen angelegten "Judenkartei" von Herrn Joachim Klose, Verein für jüdische Geschichte Gailingen e.V.; E-Mail-Auskunft Stadtarchiv Mannheim/KZ-Gedenkstätte Sandhofen, Herr Hans-Joachim Hirsch; www.holocaust.cz (Zugriff 22.2.2012); www.mannheim.de/tourismus-entdecken/mahnmal-juedischen-opfer-des-nationalsozialismus (Zugriff 22.2.2012).
Zur Nummerierung häufig genutzter Quellen siehe Link "Recherche und Quellen".