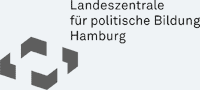Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Wilhelm Prahl * 1904
Vereinsstraße 42 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
HIER WOHNTE
WILHELM PRAHL
JG. 1904
VERHAFTET 1939
KZ NEUENGAMME
ERMORDET
Wilhelm Prahl, geb. am 21.6.1904 in Hamburg, hingerichtet am 8.8.1944 im KZ Neuengamme
Vereinsstraße 42
Wilhelm Prahl wurde 1904 als unehelicher Sohn der Arbeiterin Anna Prahl, später verheiratete Kühn, in Eimsbüttel geboren. Im Alter von einem Jahr kam er in die Pflegefamilie von Heinrich Schmidt in der Weidenallee 59, bei der er bis 1929 lebte. Nach Beendigung der Volksschule mit 14 Jahren erlernte er von 1919 bis 1923 das Schiffbauerhandwerk auf der Hamburger Werft. Er sympathisierte mit der SPD, wurde jedoch kein Parteimitglied. Im Januar 1929 heiratete er Elsa Degler (geb. 1900), Tochter eines Altonaer Zigarrenmachers, die viele Jahre Arbeiterin bei der Margarinefabrik Mohr in Bahrenfeld war und nach der Eheschließung durch Tätigkeiten in Konservenfabriken und Druckereien zum Lebensunterhalt der Familie beitrug. Aus der Ehe entstammten in den Jahren 1929, 1930 und 1939 drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne. Die Familie lebte sowohl in Altona, Große Bergstraße 201, als auch in Eimsbüttel unter verschiedenen Adressen, zuletzt in der Vereinsstraße 42. Vor seiner letzten Verurteilung im Jahr 1944 arbeitete Wilhelm Prahl auf der Deutschen Werft. Nach den verheerenden Luftangriffen im Juli/August 1943 ging er, nach eigener Aussage wegen "Mutlosigkeit", immer seltener zur Arbeit und meldete sich öfter krank.
Zwischen 1923 und 1936 wurde Wilhelm Prahl viermal wegen Sachbeschädigung und Beamtenbeleidigung, öffentlichen Musizierens, Bettelns und böswilliger Äußerungen über den "Führer" und dessen Anordnungen zu Haftstrafen verurteilt. Der letztgenannte Vorfall wurde am 3. April 1936 vom Schleswig-Holsteinischen Sondergericht in Altona als Vergehen gegen das "Heimtückegesetz" gewertet und mit fünf Monaten Gefängnis bestraft.
Im August 1939 wurde Wilhelm Prahl Opfer einer Denunziation. Er wurde bezichtigt, im Mai 1938 mit dem Schiffbauhelfer August Möller im Beisein von dessen Frau Friedel Möller gleichgeschlechtliche Handlungen vorgenommen zu haben. Die drei hätten in betrunkenem Zustand Sex miteinander gehabt, zunächst mit Friedel Möller, anschließend die Männer untereinander. Dafür wurde Wilhelm Prahl am 17. November 1939 vom Landgericht Hamburg, Strafkammer 3, zu einem Jahr Gefängnis wegen Vergehens nach § 175 verurteilt. Die Strafe verbüßte er bis zum 9. August 1940 im Strafgefängnis Fuhlsbüttel, danach wurde er "über die Gestapo" nach Hause entlassen. Er konnte dankbar sein, dass er bei seinen Vorstrafen zu diesem Zeitpunkt nicht in ein Konzentrationslager eingewiesen wurde.
Im Juni 1944 wurde Wilhelm Prahl erneut Opfer einer Denunziation. Was war geschehen? Nach den erwähnten Bombenangriffen im Juli/August 1943 stahl er drei Koffer mit Silberzeug und Kleidung aus dem Luftschutzkeller eines fast völlig ausgebrannten Wohnhauses in der Maria-Louisen-Straße 58 in Winterhude. Am nächsten Tag entwendete er zahlreiche Kleider und Mäntel aus einem teilweise zerstörten Hintergebäude einer Eimsbüttler Färberei in der Meißnerstraße 4.
Am 22. Juni 1944 wurde Wilhelm Prahl vom Hanseatischen Sondergericht als "Volksschädling gemäß § 1 der Volksschädlingsverordnung" zum Tode und dauerhaftem Verlust seiner Ehrenrechte verurteilt. Er habe sich durch seine Tat "außerhalb der Volksgemeinschaft" gestellt. Seine Frau Elsa wurde wegen Verwertung des Plünderergutes, ebenso wie eine weitere beteiligte Bekannte, zu einer Zuchthausstrafe von drei Jahren und der Aberkennung der Ehrenrechte auf die Dauer von drei Jahren verurteilt. Das Urteil gegen Wilhelm Prahl wurde am 8. August 1944 im KZ Neuengamme vollstreckt. Er starb an vierfachem Brustdurchschuss.
Da auch Elsa Prahl für anderthalb Jahre im Frauenzuchthaus Lübeck-Lauerhof einsaß, kamen die drei Kinder zunächst bei ihrem Bruder unter. Dieser beklagte sich jedoch in einem Brief gegenüber seiner Schwester über deren Lebenswandel und die Mühen, die er jetzt mit den Kindern habe. Die Übernahme einer Vormundschaft lehnte er ab.
Aus einem 1982 an die Staatsanwaltschaft verfassten Schreiben des jüngsten Sohnes von Wilhelm Prahl ist zu entnehmen, dass die Kinder kurz nach Inhaftierung der Eltern auseinandergerissen und auf verschiedene Heime verteilt wurden. Der erst knapp fünf Jahre alte Sohn sei dann von dem älteren Bruder 1945 aus dem Kinderkrankenhaus Rothenburgsort herausgeholt worden. Zudem bat dieser 1982 um die Aushändigung einer Kopie des Todesurteils des Hanseatischen Sondergerichts, um endlich über die Todesumstände seines Vaters Aufschluss zu erhalten. Auf Veranlassung der damaligen Justizbehörde wurde ihm eine solche Kopie nur unter Schwärzung der für das Urteil verantwortlichen Personen, Oberlandesgerichtsrat Günther Tiede als Vorsitzender, Landgerichtsrat Hermann Ebers und Gerichtsassessor Dammann als beisitzende Richter, Staatsanwalt Ernst Meyer-Margreth als Beamter der Staatsanwaltschaft und Justizobersekretär Mösch als Urkundenbeamter der Geschäftsstelle, ausgehändigt.
© Bernhard Rosenkranz (†)/Ulf Bollmann
Quellen: StaH 213-11 Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafsachen, 26/40 u. 4127/44; 242-1 II Gefängnisverwaltung II, Ablieferungen 4, Nr. 74 u. Nr. 84, 13 u. 16; 332-5 Standesämter, 13107 (Eintrag Nr. 4) u. 62106 (Eintrag Nr. 4); Rosenkranz/Bollmann/Lorenz, Homosexuellen-Verfolgung, S. 245–246.