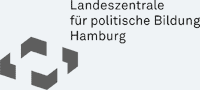Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Michaelis Löwenberg * 1856
Heymannstraße 6 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
gedemütigt / entrechtet
Flucht in den Tod
13.10.1940
Weitere Stolpersteine in Heymannstraße 6:
Rosa Rebecka Löwenberg, Henny Löwenberg
Michaelis Löwenberg, geb. am 20.10.1856 in Wunstorf bei Hannover, Flucht in den Tod am 13.10.1940
Rosa Rebecka Löwenberg, geb. Seewald, geb. am 18.6.1865 in Frankfurt a.M., deportiert am 15.7.1942 nach Theresienstadt, dort gestorben am 20.1.1944
Henny Löwenberg, geb. am 10.3.1892 in Hannover, deportiert am 11.7.1942 nach Auschwitz
Heymannstraße 6
Der Häusermakler Michaelis Löwenberg war der Sohn von Ephraim Abraham und Zaire Löwenberg, geb. Schragenheim oder Schrepenhain. Er wurde in Wunstorf im heutigen Niedersachsen geboren. Im Jahr seiner Geburt gehörte Wunstorf noch zum Königreich Hannover, das erst 1866 preußische Provinz wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es dort eine bedeutende Jüdische Gemeinde, der um 1860 fast 90 Personen angehörten. Die Gemeinde zählte damals insgesamt 2280 Einwohner. In Grundstücks- und Häuserakten in Wunstorf sind diverse Löwenbergs verzeichnet, die dort als Kornhändler, Tabakfabrikanten, Kaufleute und Lohgerber tätig waren. Auf dem Wunstorfer Judenfriedhof gibt es ein Grab von Efraim Löwenberg, der 1858 starb. Das war vielleicht Michaelis’ Vater. Auch ein Mosche Löwenberg wurde dort 1883 begraben. Dieser war ein Sohn von Efraim und demnach vielleicht ein Bruder von Michaelis.
Die Eltern seiner Ehefrau Rosa Rebecka, die laut Gedenkbuch in Frankfurt am Main geboren wurde, waren Meir (Meier, Meyer, Mayer) und Henrietta (Jettchen) Seewald, geb. Oestreich. Michaelis und Rosa Rebecka heirateten im Mai 1891 im hessischen Babenhausen, wo ihr Vater und ihre Geschwister wohnten und wo sie vermutlich aufgewachsen war. Für das Jahr 1875 sind für die Familie Mayer Seewald in Babenhausen in der Fahrstraße 26 vier männliche und sechs weibliche Personen dokumentiert. 1867 lebten in dem Ort 84 Personen jüdischen Glaubens, 3,7 Prozent von weniger als 3.000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Rosa Rebeckas Mutter Jettchen war schon im April 1876 verstorben. Für sie liegt ein Grabstein mit hebräischer Inschrift auf dem Jüdischen Friedhof in Babenhausen. Wie viele Geschwister es gab, wissen wir nicht. Eine Schwester, Scheinle, starb im Kindesalter. Auch für sie gibt es einen Grabstein. Für 1884 ist noch Mayer Seewald als Hausbesitzer dokumentiert, im Jahr 1900 sind dann die Namen Julius und Willy Seewald angegeben. Vermutlich waren beide Brüder von Rosa Rebecka. Julius lebte noch 1931 in Babenhausen. Ein Zeitzeuge erinnerte sich, dass Seewalds mit Baustoffen handelten.
Beide Ehepartner stammten aus kleinen Ortschaften. Nach der Heirat lebten sie vermutlich bis etwa 1910 in Hannover, wo in kurzen Abständen vier Töchter geboren wurden: Henny (geb. 1892), Else (geb. 1893), Flora (geb. 1895) und Irma (geb. 1897). Ab 1910 finden sich Einträge im Hamburger Fernsprechbuch. Michaelis Löwenberg betrieb ein Maklerbüro in der Kaiser-Wilhelm-Straße 82 und bis ungefähr 1918 in der Gerhofstraße 2. Die Wohnung befand sich damals in der Rutschbahn 26. Von dort zog die Familie in die Heymannstraße 6 bzw. in die Liliencronstraße, wie die Heymannstraße damals hieß. Der fünfgeschossige in Klinkerbauweise errichtete Block der Malerei-Gesellschaft (Schlankreye 3/25, Bogenstraße 43/47, Heymannstraße 6/10) wurde 1927 gebaut. Vermutlich zog das Ehepaar Löwenberg mit der Tochter Henny dort ein, sobald das Haus fertiggestellt war.
Henny Löwenberg war die einzige unverheiratete Tochter. Sie lebte bei ihren Eltern und sorgte für sie. Auf der Kultussteuerkarteikarte des Vaters ist eingetragen: "wird von der Tochter ernährt!" Henny Löwenberg arbeitete als kaufmännische Angestellte beim Bankgeschäft John M. Meyer an der Börsenbrücke, eine Arbeit, die sie vermutlich Ende 1936 verfolgungsbedingt verlor. Später fand sie noch einmal eine Anstellung im Jüdischen Krankenhaus. Ihr letzter Wohnort war wie der ihrer Eltern das May-Stift in der Bogenstraße 25.
In diesem Haus versuchte Michaelis Löwenberg am 6. Oktober 1940, sich das Leben zu nehmen. Er wurde ins Israelitische Krankenhaus in der Johnsallee eingeliefert, wo er am 13. Oktober verstarb. Als Todesursache wurde vom Arzt Rudolf Borgzinner auf dem Totenschein eine Kopfschwartenwunde und Herzmuskelschwäche diagnostiziert.
Aus dem zum "Judenhaus" gemachten Gebäude Bogenstraße 25 wurde Henny am 11. Juli 1942 nach Auschwitz deportiert. Ihre Mutter Rosa Rebecka wurde aufgrund ihres Alters wenige Tage später am 15. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert.
Die Tochter Else heiratete am 1. Januar 1941 den 1890 in Emden geborenen jüdischen Max van der Walde. Van der Waldes hatten eine Tochter Caroline (geb. 1921) und einen Sohn Simon (geb. 1924). Else arbeitete als Wirtschafterin im Heim für Jüdische Mädchen in der Innocentiastraße 21. Dort liegen Stolpersteine für Else und Max van der Walde und für ihre beiden Kinder, die 1941 nach Minsk deportiert wurden.
Flora Löwenberg war verheiratet mit Willy Sänger (s. Familie Sänger). Für Irma Löwenberg und ihren Ehemann Bruno Schragenheim liegen Stolpersteine in der Brahmsallee 13.
Nachtrag: Am 18. August 1942 wurden zwei silberne Esslöffel und zwei silberne Teelöffel von Henny Löwenberg öffentlich versteigert und erbrachten 15 Reichsmark. Das ist die letzte Spur, die sich von der Familie fand.
© Susanne Lohmeyer
Quellen: 1; 4; 5; 7; Hamburger Fernsprechbücher; HAB II 1931; StaH 214-1 Gerichtsvollzieherwesen, 463; StaH 331-5, 3 Akte 1940/1770; StaH 332-5 Standesämter, 8169 und 514/1940; StaH 351-11 AfW 090132 Jack Black; Auskunft vom Stadtarchiv Wunstorf; Juden in Niedersachsen, Bd. 2, S. 1591ff.; Helga Schmal, Eimsbüttel und Hoheluft-West, S. 60; Klaus Loetsch u. a., Die Juden von Babenhausen, S. 231ff.; Kleinanzeige Hamburger Familienblatt vom 1.10.1936.
Zur Nummerierung häufig genutzter Quellen siehe Link "Recherche und Quellen".