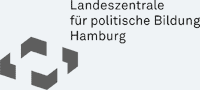Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Erna Löw (geborene Fries) * 1880
Eimsbütteler Chaussee 90 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
1941 Riga
ermordet
Weitere Stolpersteine in Eimsbütteler Chaussee 90:
Leo Löw
Erna Löw, geb. Fries, geb. am 25.11.1880 in Altona, deportiert am 6.12.1941 nach Riga
Leo Löw, geb. am 22.2.1876 in Hamburg, 1941 inhaftiert, deportiert am 4.12.1941 nach Riga
Eimsbütteler Chaussee 90
Leo Löw war der Sohn des Kaufmanns Joseph Löw und dessen Ehefrau Rosa, geb. Lichtenstaedt. Er hatte zwei Schwestern, Babette und Lilly, und wohnte als Kind in der Heinrich-Barth-Straße 10 in Rotherbaum. Bevor die Familie in den Grindel zog, hatte sie in der Neustadt Auf dem Neuerwall Nr. 94 gewohnt, wo Leo Löw auch geboren wurde. Der Vater starb 1926.
Leo Löw heiratete 1907 die Hamburger Jüdin Erna Fries, die Tochter von Isidor Fries und dessen Ehefrau Fanny, geb. Gabriel. Ihre Eltern wohnten 1880 in St. Pauli in der Neuen Rosenstraße 31. Als Erna und Leo Löw heirateten, wohnte Erna in der Paulinenstraße 15 und Leo in der Großen Allee 10 (heute Max-Brauer-Allee). Beide lebten noch bei ihren Familien. Leo Löw war "Bankbeamter", wie es damals hieß. Er war Börsenvertreter für das Bankgeschäft Emil Heckscher und arbeitete später als Versicherungsagent.
Erna und Leo Löw bekamen drei Töchter: Ingeborg, genannt Babette (geb. 1908), Hildegard Rita (geb. 1913) und Gisela Gabriele, genannt Gisa (geb. 1916). Als die Familie sich vergrößerte, zog sie 1913 in den vierten Stock des Hauses Eimsbütteler Chaussee 90 und wohnte dort bis Januar 1936, als ein Umzug in die Grindelallee 93 erfolgte. Die letzte Adresse war die Parkallee 8. Dort lebten Löws zu Beginn des Jahres 1939, als sie die Zwangsnamen Sara und Israel annehmen mussten.
Die drei Löw-Töchter überlebten dank ihrer Emigration – aber Emigration bedeutete nur selten ein "happy end", sicherte nur das Überleben, oft verbunden mit traumatischen Verfolgungserlebnissen, Entwurzelung und Armut. Ingeborg Babette z. B. war sprach- und hörbehindert, was für sie das Leben in der Emigration noch belastender machte. Nach der Höheren Mädchenschule Krüger in der Barstelsstraße bis 1923 hatte sie das Lyzeum von Else Weissmann in der Weidenallee besucht, woran sich ein privates 10. Schuljahr anschloss. Bei der Firma Simon Arendt, Sonderhaus moderner Damenkleidung, am Neuen Wall 35 machte sie dann eine Schneiderlehre, besuchte von Mai 1925 bis September 1927 die Staatliche Fachgewerbeschule und bestand die Gesellenprüfung. Bis 1932 arbeitete sie bei der Firma Gebr. Robinsohn. Anschließend qualifizierte sie sich weiter, besuchte am Mundsburger Damm die Fachschule für das Damenschneidereigewerbe von Ida Mähl und legte die Meisterprüfung ab. Genau zu dem Zeitpunkt, als sie beruflich am Ziel zu sein schien, übernahmen die Nationalsozialisten die Macht und verweigerten ihr als Jüdin eine erfolgreiche berufliche Laufbahn. Schon die Ausstellung des Meisterbriefs wurde ihr verwehrt, aber im März 1933 konnte sie ein Gewerbe anmelden und wurde im Mai 1933 in die Handwerksrolle eingetragen. Anfang 1933 hatte sie noch an einer Modenschau im Hotel Atlantic teilnehmen können, schon einige Monate später war ihr das nicht mehr erlaubt. Im Hamburger Familienblatt warb sie im November 1933 mit einer Kleinanzeige um Kunden. Als Jüdin durfte sie keine Lehrlinge ausbilden, beschäftigte aber bis Herbst 1938 heimlich fünf Mädchen als Zuarbeiterinnen. Kurz vor ihrer Auswanderung nach Palästina heiratete sie 1938 pro forma, weil ihr Mann ein Auswanderungszertifikat besaß. Allerdings lebte sie nie mit ihm zusammen, und 1945 wurde die Ehe offiziell geschieden. Es war ihr kaum möglich, beruflich in Palästina Fuß zu fassen, da sie behindert und ganz auf sich allein gestellt war. Im September 1958 kehrte sie nach Hamburg zurück.
Die Schwester Hildegard Rita wanderte schon im April 1937 nach England aus. Eigentlich hatte sie geplant, sich mit ihrer Schwester Ingeborg Babette zusammen selbstständig zu machen und sich gemeinsam mit der Schwester eine Existenz in der Modebranche zu erarbeiten. Deshalb hatte sie nach dem Besuch der Staatlichen Höheren Handelsschule Schlankreye Anfang 1932 im Modehaus Unger volontiert. Nach 1933 war es ihr aber nur noch möglich, als Kinderpflegerin in Privathaushalten zu arbeiten.
Die jüngste Tochter Gisa Gabriele hatte schon während ihrer Schulzeit stark unter antisemitischen Angriffen von Lehrern und Mitschülern leiden müssen, die ihr diese Zeit vergällten und sie daran hinderten, eine Schule in Hamburg bis zum Abschluss zu besuchen. Das galt sowohl für die Emilie-Wüstenfeld-Schule als auch für die Handelsschule Schlankreye. Von Frühjahr 1934 bis Oktober 1935 arbeitete sie als Kindermädchen und fuhr dann für einige Monate nach Scheveningen, eine Reisemöglichkeit, die ihr ihr Großvater Isidor Fries vermittelt hatte. Im April 1936 kehrte sie nach Hamburg zurück, weil sie hoffte, durch die Olympischen Spiele habe sich das judenfeindliche Klima verbessert. Als sie aber im Oktober 1937 von der Gestapo vorgeladen wurde und ihren Pass abgeben sollte, floh sie überstürzt nach Holland und emigrierte im Februar 1938 nach England.
Die Eltern blieben allein in Hamburg zurück. Anfang Dezember 1941 erhielten sie den Deportationsbefehl nach Riga-Jungfernhof, wo sie zu Tode kamen.
Der Vater von Erna Löw, Isidor Fries (geb. 1.10.1855), der im Heussweg 16 und zuletzt im "Judenhaus" in der Beneckestraße 6 wohnte, wurde am 9. Juni 1943 nach Theresienstadt deportiert und starb dort am 10. August 1943.
© Susanne Lohmeyer
Quellen; 1; 4; 5; 8; StaH 332-5 Standesämter, 3091 + 272/1907; StaH 332-5, 1879 + 941/1876; StaH 332-5, 1985 + 5571/1880; StaH 351-11 AfW, 2977;2978;2979; StaH 522-1, 992e2 Bd. 5, Deportationsliste; Hildegard Thevs, Stolpersteine in Hamburg-Hamm, S. 40, HAB I, II und IV, 1933–1943.
Zur Nummerierung häufig genutzter Quellen siehe Link "Recherche und Quellen".