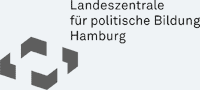Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Louis Lübeck * 1879
Heußweg 9 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
HIER WOHNTE
LOUIS LÜBECK
JG. 1879
1938 – 1943 HAFT
DEPORTIERT 1943
AUSCHWITZ
ERMORDET 11.5.1943
Louis Lübeck, geb. am 21.4.1879 in Hamburg, mehrfach inhaftiert in Fuhlsbüttel, von dort am 28.3.1943 nach Auschwitz deportiert und am 11.5.1943 ermordet
Heußweg 9 (Heußweg 11)
"Im Februar 1943 wurde mein Mann von seinem derzeitigen Arbeitsplatz in der Gewürzmühle Christian Wolf, Grüner Deich, telefonisch zur Gestapo nach der Rothenbaumchaussee berufen und ohne nähere Angabe von Gründen erneut verhaftet.
Die Gestapo stellte ihn vor folgende Wahl:
1) entweder Ehescheidung und Abtransport ins Getto nach Theresienstadt (angeblich Los 1. Klasse für Juden seiner Altersstufe) oder
2) Einweisung für unbestimmte Zeit in ein Arbeitslager
Da mein Mann es ablehnte, sich scheiden zu lassen, weil er sich nicht von mir und den Kindern trennen konnte, transportierte man ihn im März 1943 nach Auschwitz, wo er lt. Sterbeurkunde am 11. Mai 1943 verstorben ist."
Diese Angaben fanden sich in der Wiedergutmachungsakte für den Hamburger Kaufmann Louis Lübeck. Sie stammten von seiner Ehefrau Käthe. Der sachliche Ton und die bürokratische Form können nicht das Drama verbergen, das in Louis Lübecks Ablehnung einer Scheidung ihren Höhepunkt fand und sein Todesurteil besiegelte.
Louis Lübeck war 1879 als zweites Kind des jüdischen Kürschners Baruch Bernhard Lübeck und dessen jüdischer Frau Julia, geborene del Monte, in Hamburg zur Welt gekommen. Seine Schwester Charlotte war knapp zwei Jahre älter als er, nach ihm wurden noch Jacob (1881; siehe "Stolpersteine in Hamburg-St. Pauli: Biografische Spurensuche", S. 135), Leonore Louise (1882) und Johanna (1887) geboren. Laut Louis Lübecks Worten hatte die Familie stets "mit Armut zu kämpfen". Trotzdem ermöglichten die Eltern ihrem ältesten Sohn den Besuch der neunstufigen Stiftungsschule von 1815. Einst als reformorientierte Freischule für arme jüdische Kinder gegründet, unterrichtete sie Ende des 19. Jahrhunderts überwiegend christliche Schülerinnen und Schüler.
Im Frühjahr 1895 beendete Louis Lübeck die Schule mit der mittleren Reife und absolvierte anschließend beim Hamburger Exporthaus Frankfurter & Liebermann in der Admiralitätstraße eine Lehre als Exportkaufmann. In seiner Freizeit lernte er Englisch, Französisch und Spanisch. Nach der Ausbildung übernahm ihn die Firma, und er arbeitete dort bis 1903 als "Commis", als kaufmännischer Angestellter. Dann kündigte er, um "seine geschäftlichen Kenntnisse zu erweitern", wie es in seinem Zeugnis hieß. Die Zielstrebigkeit, mit der er seine berufliche Karriere verfolgte, zeigte sich auch darin, dass er nun für zwei Jahre nach England ging, um Auslandserfahrungen zu sammeln. Mit Anfang Zwanzig kehrte er nach Hamburg zurück und war die nächsten zehn Jahre bei verschiedenen Firmen als kaufmännischer Angestellter beschäftigt, darunter als Leiter der Musterabteilung bei der Import-Export-Firma B. Luria & Co. am Jungfernstieg. In jener Zeit legte er auch in einer feierlichen Zeremonie den Hamburger Bürgereid ab. Er schwor, "das Beste der Stadt [zu] suchen und Schaden von ihr ab[zu]wenden, soviel ich vermag", und erwarb damit das hamburgische Bürgerrecht – Voraussetzung für geschäftliches wie gesellschaftliches Ansehen in der Hansestadt. Schließlich folgte der Schritt in die Selbstständigkeit: Am 21. Oktober 1910 meldete Louis Lübeck bei der Gewerbe- und Verkehrspolizei Süd-Eimsbüttel einen "selbständigen Gewerbebetrieb" an, vier Tage später ließ er die "Fa. Louis Lübeck" ins Handelsregister eintragen, als Exportvertretung für verschiedene Unternehmen mit Sitz in Deutschland und England. Damals wohnte er noch zur Untermiete in der Bundesstraße 11. Die Arbeit bestimmte den größten Teil seines Lebens, ehrgeizig baute er seine Firma auf. Über sein Privatleben in jener Zeit ist nichts bekannt.
Im Oktober 1923, mit 44 Jahren, gründete Louis Lübeck eine Familie: Er heiratete die 23-jährige Käthe Amanda Emma Konow, Tochter des evangelischen Klempnermeisters August Konow aus Eimsbüttel. Ein gutes Jahr später wurde das erste Kind des Ehepaars geboren: Allis Julia Louise.
Mit der gleichen Intensität, mit der Louis Lübeck seinem Beruf nachging, liebte er seine Familie. Gleichwohl stand die Arbeit weiterhin im Mittelpunkt. Aus dem Sohn eines armen, kinderreichen Pelzverarbeiters aus Hamburg-St. Pauli war ein angesehener Kaufmann mit Geschäftsräumen in der Großen Bäckerstraße unweit des Rathauses geworden, der zwei Angestellte beschäftigte und zahlreiche Kunden in Deutschland und England hatte. Dabei folgte er dem Leitbild der traditions- und einflussreichen Hamburger Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns, deren Mitglied er 1912 geworden war. Wie stolz er auf diese Mitgliedschaft war, zeigt die Tatsache, dass er sie im Hamburger Adressbuch als Zusatz zu seinem Namen eintragen ließ. Er besaß zudem zahlreiche Wertpapiere und lebte mit seiner Familie mittlerweile im Heußweg 11.
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 und die damit einhergehenden Veränderungen im politischen und gesellschaftlichen Leben Deutschlands hatten offenbar zunächst kaum Einfluss auf sein Leben. Die zunehmenden Einschränkungen und Verfolgungen, denen gläubige Jüdinnen und Juden sowie all jene Menschen ausgesetzt waren, die der Staat 1935 durch die Nürnberger Rassegesetze zu Juden erklärt hatte, schienen ihn nicht zu beunruhigen. Bestätigung für seine Haltung fand er möglicherweise dadurch, dass ihm noch im August 1935 das Ehrenkreuz für Frontkämpfer im "Namen des Führers und Reichskanzlers" Adolf Hitler "zur Erinnerung an den Weltkrieg 1914/1918" verliehen wurde. Auch war er als Ehemann einer christlich getauften Frau und damit, im späteren NS-Vokabular, in "privilegierter Mischehe" lebend, tatsächlich noch vor staatlicher Verfolgung geschützt.
Die ersten Schwierigkeiten trafen seine Tochter Allis. Sie besuchte die 7. Klasse der Emilie-Wüstenfeld-Schule, die im Sommer 1937 für zwei Tage nach Lüneburg fahren wollte. Nichts ahnend gab Allis ihrem Lehrer das Reisegeld und musste erfahren, dass sie als "Halbjüdin" von der Fahrt ausgeschlossen sei: Die Jugendherberge würde sie nicht aufnehmen. Daraufhin schrieb Louis Lübeck an die damalige Kultur- und Schulbehörde und bat inständig darum, seine Tochter nicht gegenüber den Klassenkameraden zurückzusetzen: "(…) Ich gestatte mir, dazu einige Erläuterungen zu geben, um meinem einzigen Kind den Weg ins Leben & zum Deutschen Staate zu ebnen. Ihre Mutter, meine Frau ist aus guter evg. luth. Familie. Ich persönlich habe niemals einer Religion oder einer Gemeinde oder Sekte angehört, als Schüler der Ree’schen Realschule (Simultanschule) bin ich absolut im freiheitlichen Geiste erzogen worden. Mein Vater, Veteran von 1870/71 hat 3 Jahre bei den 76er Hanseaten gedient & ich habe als Frontkämpfer das Ehrenkreuz & Verwundetenabzeichen erworben, wir sind mit Gut & Blut für Deutschland eingetreten. Alles für Deutschland, so soll auch mein Kind erzogen werden & seine Pflicht thun." In einem weiteren Schreiben drückte er seine Sorge darüber aus, dass seine Tochter unter der Zurückweisung seelisch leiden, die Freude an der Schule verlieren und in Konflikte geraten könnte, vor denen ihre Eltern sie bislang stets bewahrt hätten. Schließlich durfte Allis doch an der Reise teilnehmen.
Bis zu 50 Kunden hatte Louis Lübeck laut Rademachers Firmenregister für Industrie und Exporthandel 1938. Dazu gehörten der Hannoveraner Spielautomatenhersteller Dewag und die Maschinenbaufirma Igetro aus Zuffenhausen bei Stuttgart ebenso wie die Mielewerke Gütersloh und der Steinguthersteller Doulton & Co. in London. 1938 änderte sich seine berufliche Situation jedoch dramatisch. Zunächst schloss der Verein eines Ehrbaren Kaufmanns seine jüdischen Mitglieder aus, wozu er sich im Zuge einer Verordnung des Reichswirtschaftsministeriums über den Ausschluss der Juden von der Börse angeblich gezwungen sah. Davon war auch Louis Lübeck betroffen.
Ein im Juli 1938 erschienener Artikel in "Das schwarze Korps. Zeitung der Schutzstaffeln der NSDAP", dem Kampf- und Werbeblatt der SS, zog ihm dann endgültig den Boden unter den Füßen weg. Unter der Überschrift "Louis, der hartnäckige Arier" beschrieb ein nicht genannter Verfasser in einem langen, sarkastischen Hetzartikel Louis Lübecks "Entlarvung" als "Volljuden", der mit allen nur möglichen Tricks versucht hätte, sich seinen Geschäftspartnern gegenüber als "Arier" auszugeben, und bezichtigte ihn zudem des Betrugs. Begründung: Er hätte seine Firma auf seine "arische" Ehefrau überschrieben und sich so "Vermögensvorteile verschafft". Rund vier Wochen später, am 20. August, wurde Louis Lübeck von der Gestapo verhaftet und ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel gebracht. Zehn Monate saß er in Untersuchungshaft. Am 23. Juni 1939 fiel das Urteil: Wegen "Verbrechen gegen die Tarnungsverordnung" wurde er zu einem Jahr und sechs Monaten Strafhaft sowie zur Zahlung einer Geldstrafe von 1.000 Reichsmark (RM) verurteilt. Das Gericht bezog sich dabei auf die erst vier Monate zuvor erlassene "Verordnung gegen die Unterstützung der Tarnung jüdischer Gewerbebetriebe". Laut § 1 dieser Verordnung konnte "ein deutscher Staatsangehöriger, der aus eigennützigen Beweggründen dabei mitwirkt, den jüdischen Charakter eines Gewerbebetriebes zur Irreführung der Bevölkerung oder der Behörden bewußt zu verschleiern, mit Zuchthaus, in weniger schweren Fällen mit Gefängnis, jedoch nicht unter einem Jahr, und mit Geldstrafe bestraft" werden. Louis Lübecks Frau Käthe schrieb dazu später in ihrem Antrag auf Wiedergutmachung: "Der Geschädigte war Volljude und mit mir in privilegierter Mischehe (1 Kind) verheiratet. Als 1938 – mein Mann stand bereits im 59. Lebensjahr – noch unser zweites Töchterchen geboren wurde, während sich die NS-Gesetze gegen die Juden mehr und mehr verschärften und auch auf die so genannten ,freien‘ Berufe übergriffen und unsere Existenz bedrohten, entschloss sich mein Mann, durch Firmenübertragung auf mich sein Geschäft zu arisieren. Dies wurde ihm zum Verhängnis. Die Gestapo verhaftete ihn, versiegelte sein Büro und untersagte auch die Weiterführung seines Geschäftes." Es war das erste "Tarnungsdelikt", das ein Hamburger Gericht verurteilte.
Bereits die Untersuchungshaft war für Louis Lübeck kaum erträglich gewesen, das Urteil stürzte ihn in eine tiefe Depression. Anfang Juli 1939 schilderte er "mit dem Mut der Verzweiflung" in einem langen Schreiben voller Selbstvorwürfe ob seines "Fehlers" dem Hamburger Schwurgericht seine Gefühle – dabei sicher wissend, dass dies nichts an seiner Lage ändern würde. Regelmäßig beantragte Käthe Lübeck, ihren Mann besuchen zu dürfen. Vor allem lag ihr daran, dass er seine Kinder sah: die mittlerweile 15-jährige Allis und die kleine Ilse Angelika, die erst im April 1938 geboren worden war. Ende 1939 stellte sie ein Gnadengesuch an den Anstaltsvorsteher, dass dieser wenig später ohne Begründung ablehnte. Daraufhin reichte sie eine Beschwerde beim zuständigen Oberstaatsanwalt gegen die Ablehnung ein. Mittlerweile hatte Louis Lübeck eine Arbeit als Bastisolierer zugewiesen bekommen. Kurz nach Abweisung der Beschwerde zeigte der zuständige Werkmeister ihn bei der Anstaltsleitung an: Lübeck habe durch zusammengedrehten Bast die Toilettenabflussleitung verstopft und sei aufsässig geworden, als er das Wasser in der Zelle aufwischen sollte. Auch arbeite er weit unter Pensum, sei deshalb bereits verwarnt worden. Die Strafe lautete auf sieben Tage Arrest. Wenige Tage später stellte Käthe Lübeck erneut ein Gnadengesuch. Wieder wurde dieses ohne Angabe von Gründen abgelehnt.
Gemäß der "Verordnung über eine Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit" vom 12. November 1938 hatte Louis Lübeck bereits zwischen Mitte Dezember 1938 und Mitte August 1939 in vier Raten eine "Judenvermögensabgabe" von fast 6.000 RM an das Deutsche Reich zahlen müssen. Da er seither kein Einkommen hatte, lebte seine Familie vom Ersparten. Anfang 1940 musste Käthe Lübeck zudem gemäß einer "Sicherungsanordnung" das gesamte noch vorhandene Vermögen ihres Mannes auf ein so genanntes Sicherungskonto bei einer Devisenbank einzahlen und seine Wertpapiere dort hinterlegen. Von diesem Konto durfte sie monatlich nur noch 475 RM abheben, wobei die Bank außer Datum und Summe jeweils auch den Grund der geleisteten Zahlungen vermerkte. Da die Anordnung des Reichswirtschaftsministers ebenso für das Vermögen der "arischen" Ehefrau eines Juden galt, hatte sie zudem keinen Zugriff auf ihr eigenes Konto.
Als Louis Lübeck Ende April 1940 aus der Strafhaft entlassen wurde, war er, so seine Ehefrau später in ihrem Wiedergutmachungsantrag, ein "seelisch und körperlich gebrochener Mann". Gleichwohl kam eine Auswanderung für ihn nicht in Frage. Seine Frau und die beiden Töchter seien evangelisch-lutherisch, seine Frau zudem "vollarisch", argumentierte er. Stattdessen bemühte er sich intensiv darum, sich eine neue Existenz aufzubauen, um seine Familie ernähren zu können. Da er in "privilegierter Mischehe" lebte, erlaubte es ihm die Gauleitung der Hansestadt, sich "im Angestelltenverhältnis kaufmännisch zu betätigen". Im Einzelfall brauchte er dazu jedoch die Zuweisung durch Willibald Schallert, der beim Arbeitsamt Hamburg für die Vermittlung von Juden zuständig war. Verschiedene Firmen bekundeten Interesse, als Louis Lübeck sich bei ihnen bewarb. Doch Schallert – so Käthe Lübeck 1947 im Rahmen des Verfahrens am Hamburger Landgericht gegen ihn – habe ständig Schwierigkeiten gemacht und versucht, ihren Mann für eine körperliche Arbeit einzuteilen. Nach fast drei Jahren gelang es Louis Lübeck schließlich Anfang Januar 1943, doch noch Schallerts Genehmigung für eine Beschäftigung zu bekommen. Doch "die Freude sollte nicht lange dauern", so Käthe Lübeck. Nach nur einem Monat musste ihr Mann am 1. Februar 1943 plötzlich direkt von seinem Arbeitsplatz bei der Gewürzfabrik Christian Wolf am Hammerbrooker Grünen Deich in die Gestapo-Dienststelle an der Rothenbaumchaussee 38 kommen. Dort wurde er sofort verhaftet, nach Fuhlsbüttel gebracht und in "Schutzhaft" genommen. Offensichtlich hatte Schallert ihn bei der Gestapo angezeigt, weil er seine Bewerbung bei der Betriebskrankenkasse der Deutschen Werft nicht mit dem Zwangsnamen "Israel" unterzeichnet hatte. Insgesamt betraf diese Verhaftungsaktion unter verschiedenen Vorwänden 17 in Mischehe lebende Juden.
Nach acht Wochen Haft in Fuhlsbüttel wurde Louis Lübeck am 28. März 1943 nach Auschwitz gebracht. Von dort schrieb er seiner Familie noch eine letzte Karte: "Es geht mir gut, bin gesund & fühle mich wohl. Ich würde mich sehr freuen von Euch bald eine gute Nachricht zu erhalten. Es grüsst Euch Euer Pappi." Am 11. Mai 1943 starb er.
Als ausgebombte "Butenhamborgerin" arbeitete Käthe Lübeck ab 1945 zunächst in Bargteheide, ab 1950 beim Arbeitsamt in Hamburg. Sie starb 1972.
Allis Lübeck war von 1948 bis 1949 fast ein Jahr lang im UKE in stationärer psychologischer Behandlung. Sie nahm sich später das Leben.
Ilse Lübeck wohnt mit ihrem Mann in Hamburg. Sie hat zwei Söhne und fünf Enkel.
Im Holocaust starben außerdem Louis Lübecks Schwester Leonore, verheiratete Stollberg, am 21. Januar 1942 in Theresienstadt und sein Bruder Jacob. Dieser war vom KZ Dachau in die Tötungsanstalt Hartheim gebracht und dort am 15. Mai 1942 ermordet worden.
Das Verfahren gegen Willibald Schallert wurde im Fall Louis Lübeck "mangels Beweises" eingestellt.
© Frauke Steinhäuser
Quellen: 1; 2 (R 1940/113); 9; StaH 213-11, Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafsachen, 11 Js 1154/38; ebd., 63701/53 Schallert; StaH 242-1 II, Gefängnisverwaltung II, Abl. 18, 923/39 Gefangenenpersonalakte Louis Lübeck; StaH 351-11 Amt für Wiedergutmachung, Abl. 2008/1 210479 Eg Käthe Lübeck, Ilse Lübeck, Allis Lübeck; StaH 361-2 II Oberschulbehörde (Höheres Schulwesen), A 29 Nr. 21; Adressbücher Hamburg 1938, 1939, 1940; Postel, Kaufmännische Selbstverwaltung; www.veek-hamburg.de (Zugriff 31.3.2008, inzwischen überarbeitet ohne Unterseite zur Geschichte); Anträge auf Eintragung in das Register Eines Ehrbaren Kaufmanns, Bd 5 L–M; Ehrbarer Kaufmann, Mitgliederverzeichnis A–L; Ausschluß von Juden aus dem Reg. E. E. K. u. Eintragungen von Mischlingen in das Reg. E. E. K., Akte Nr. 505/39; Gespräch mit Ilse Ulmer, geb. Lübeck, Michael Lübeck und Dorothee Kern-Lübeck am 7.3.2011 in Hamburg; Jungblut/Ohl-Hinz, Stolpersteine in Hamburg-St. Pauli; Meyer, Jüdische Mischlinge, S. 199.
Zur Nummerierung häufig genutzter Quellen siehe Link "Recherche und Quellen".