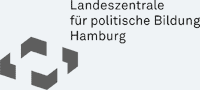Namen, Orte und Biografien suchen
Bereits verlegte Stolpersteine
Suche
Bernhard Rosenstein * 1910
Heußweg 110 (Eimsbüttel, Eimsbüttel)
HIER WOHNTE
BERNHARD
ROSENSTEIN
JG. 1910
VERHAFTET
KZ FUHLSBÜTTEL
ERMORDET 23.4.1945
KZ NEUENGAMME
Bernhard Max Emil Rosenstein, geb. am 14.10.1910 in Hamburg, am 28.2.1945 als "Schutzhäftling" im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel inhaftiert, zwischen dem 22. und dem 24.4.1945 im KZ Neuengamme ermordet
Am Abend des 20. April 1945, die britische Armee stand bei Lauenburg an der Elbe, wurden im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel 71 "Schutzhäftlinge" der Gestapo, 58 Männer und 13 Frauen, auf Lastwagen verladen, in das Konzentrationslager Neuengamme gebracht und in den Nächten vom 22. bis zum 24 April im Arrestbunker des Lagers grausam ermordet: Sie wurden erwürgt, von Handgranaten zerfetzt, erschlagen, die meisten von ihnen wurden nacheinander mit Kopfschuss getötet.
Alle 71 Personen hatten auf einer Liste von "besonders gefährlichen Personen" gestanden, die von der Gestapo und der SS-Führung des Wehrkreises X Waterkant zusammengestellt worden war. Sie waren "unbedingt zu liquidieren", sobald alliierte Truppen sich Hamburg näherten. Unter den Getöteten befanden sich 37 polnische und sowjetische Zwangsarbeiter, von denen weder die Namen noch die Gründe für ihre Liquidation bekannt sind. Zu den namentlich bekannten 34 Opfern zählt Bernhard Max Emil Rosenstein.
Wie bei etlichen anderen, die in dem Massaker beseitigt wurden, war trotz umfangreicher Recherchen auch bei Bernhard Rosenstein nicht zweifelsfrei herauszufinden, was ihn für Gestapo und SS zu einem "unbedingt zu beseitigenden Element" gemacht haben könnte.
Bernhard war am 14.10.1910 in Hamburg geboren worden. Auch die Eltern, der gelernte Buchbinder Max Rosenstein (23.4.1872–2.9.1956), und Anna Auguste Emilie Rosenstein (15.1.1877–28.4.1955), geborene Jürs, waren Hamburger. Der Vater gehörte der jüdischen Gemeinde an, die Mutter kam aus einer protestantischen Familie und galt in der NS-Zeit als "arisch". Beide waren als Kinder an Diphtherie erkrankt und taubstumm geworden, scheinen mit ihrer Beeinträchtigung aber gut zurechtgekommen zu sein. Max Rosenstein war für einige Jahre Vorsitzender des Hamburger Gehörlosenverbandes.
Bernhard war das jüngste von drei Kindern. Vor ihm geboren waren Walter (*18.4.1899) und Olga (*31.5.1901). Alle wurden evangelisch getauft.
Finanziell war es in der Familie Rosenstein, auch bedingt durch die Behinderungen, stets knapp. In den zwanziger Jahren war Max Rosenstein, der Vater, verschiedentlich arbeitslos, die jüdische Gemeinde erließ ihm einen Großteil der Kultussteuer.
Dennoch machten sich sowohl Walter als dann auch Bernhard nach der Volksschule nicht gleich ans Geldverdienen, sondern gingen in die Lehre.
Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten verlor der Vater seine Anstellung als Buchbinder und wurde Arbeiter an der Pappschere in der Kartonagenfabrik Küstermann, bei geringerem Lohn und mit den nun erhöhten Sozialabgaben für Juden. Die beiden Söhne unterstützen die Eltern mit monatlichen Zuwendungen. Als Walter 1944 an Krebs starb, sprang der Schwiegersohn Theo Gebert ein, der Ehemann der Tochter Olga.
Wie Bruder Walter lernte Bernhard den Beruf des Kaufmanns, und zwar im Altonaer Kurzwarengeschäft von Gütermanns Nähseiden. Nach einigen Jahren der Arbeit im Betrieb vor Ort ging er für das Unternehmen als Handelsvertreter auf Reisen. Er fuhr gern Auto und machte schließlich einen Beruf daraus. Er wurde Kraftwagenfahrer und fand eine Anstellung bei dem Droschken- und Fernfahrunternehmen Ludwig Pank am Peuter Elbdeich 7 auf der Veddel. Hier war er bis zu seiner Verhaftung am 28. Februar 1945 tätig. In dem Schreiben von Bernhards Arbeitgeber an die Hamburger Sozialbehörde vom 30.8.1951 heißt es: "Ich bin in der Lage, dem Kraftfahrer Bernhard Rosenstein das beste Zeugnis auszustellen. Dieser war während der angegebenen Zeit bei mir als Fahrer tätig. Seine sympathische Umgangsweise hat ihn auch der Kundschaft gegenüber sehr beliebt gemacht. Sein Verhalten im Betrieb war einwandfrei. Als Grund seiner Verhaftung kann ich mit aller Wahrscheinlichkeit nur seine Abstammung als Halbjude ermitteln …"
Seit dem 3.3.1936 war Bernhard Rosenstein verheiratet mit Ingeborg de Groot, geboren am 16.1.1914 in Hamburg, einer gelernten Kartonagenkleberin. Auch sie war nach der NS-Rassenideologie eine sogenannte Halbjüdin. Ihre Mutter war das in Hamburg St. Pauli, Marktstraße 7, lebende Dienstmädchen Bertha de Groot (*18.6.1893 in Hamburg), Jüdin niederländischer Herkunft. Der Vater Ingeborgs war der Bahnarbeiter Carl Sinn. Ingeborg war bei Pflegeeltern aufgewachsen, dem Maschinenarbeiter August Eduard Groth (*8.9.1886 in Altona), und dessen Ehefrau Martha Elise (geb. Meyer, *29.3.1892 in Altona), die im Heußweg 90/Stadtteil Eimsbüttel wohnten. 1922 kam bei Groths eine leibliche Tochter, Edith, hinzu.
Nach der Heirat nahmen sich Bernhard, der bis dahin bei den Eltern in der Mansteinstraße 29, 2. Stock, gewohnte hatte, und Ingeborg eine Wohnung im Heußweg 110, 2. Stock rechts, mit Ausrichtung zum Hinterhof. Hier wurde Bernhard später, am 28. Februar 1945 verhaftet.
Detailliertere Informationen zu den Lebenswegen der beiden bis dahin konnten wir nicht finden. Am 6.1.1937 kam der erste von zwei Söhnen zur Welt, Hans-Jürgen. Ihm folgte am 9.12.1939 Hans-Joachim. Beide leben in Hamburg, haben aber nur begrenzte Kenntnisse von der Biographie des Vater. Bei der Verhaftung des Vaters war der Ältere von ihnen gerade acht Jahre alt geworden, der Jüngere fünf.
Unter den Fotos von Vater und Mutter, die sie besitzen, zeigt eines Bernhard Rosenstein in der Ausgehuniform eines Unteroffiziers des Heeres. Es ist zu unscharf, um weitere Details feststellen zu können. Auf der Rückseite des Fotos ist per Hand vermerkt: "1940, Hindenburgkaserne Schwerin". Genauere Angaben zu Bernhards Aufenthalt in der deutschen Wehrmacht, vielleicht für begrenzte Zeit im Ersatzheer, konnten auch über die Wehrmachtauskunftstelle (WAST) des Bundesarchivs bis dato nicht ermittelt werden. Immerhin ist belegt, dass in der Schweriner Kaserne 1940 die Nachrichtenabteilungen 12 des Heeres, die 14. Panzerabwehrkompanie des 89. Infanterieregiments sowie die zugeordneten Ersatz- und Ausbildungs-Bataillone stationiert waren. 1941 wurden diese Einheiten umgruppiert und zum Teil an die Ostfront, zum Teil an die Westfront verlegt. Von Bernhards Bruder Walter ist bekannt, dass er zum Wehrdienst eingezogen worden war, doch als sogenannter Halbjude 1941 wieder entlassen wurde.
Irritierend sind zudem die Eintragungen in Bernhards Arbeitsbuch, das Arbeitnehmer seit 1935 führen mussten, und in seinem Beitragsregister bei der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte (RfA). Danach war er vom 1.10.1933 bis zum 30.11.1943 durchgehend als kaufmännischer Angestellter tätig, dann als nicht mehr fest angestellter Kraftfahrer. Diese Herabstufung im Status dürfte mit dem Druck der rassistischen NS-Politik auf den Arbeitgeber zu jener Zeit, Ludwig Pank, zu erklären sein, der Bernhard wohlgesonnen war, wie der oben erwähnte Brief zeigt.
Für immer in der Erinnerung ist den beiden Söhnen Bernhard Rosensteins die Verhaftung ihres Vaters. Am Nachmittag des 28. Februar 1945, einem Mittwoch, spielten sie im Flur der elterlichen Wohnung am Heußweg 110. Es dämmerte bereits, bald würde der Vater mit einem der Lieferwagen der Firma von der Arbeit nachhause kommen. Sie würden ihn hören, wenn er in den Hof hinter dem Haus fährt, um das Auto dort wie üblich über Nacht abzustellen. Aber da klingelte es an der Wohnungstür, zwei Männer traten herein, schwarze Ledermäntel, schwarze Schlapphüte, wie im Bilderbuch. Es war Gestapo. Sie verlangten nach Bernhard Rosenstein. Da der noch nicht da war, schickten die Männer die Familie in die Küche, die Tür hatte offen zu bleiben. Sie nahmen sich zwei Stühle und setzen sich in den Flur, mit Blick in die Küche und zur Wohnungstür. Als Ingeborg Rosenstein im Hof ein Motorengeräusch hörte, versuchte sie unauffällig zur Tür des Balkons zu kommen und vielleicht ein warnendes Zeichen zu geben. Doch einer der Gestapo sprang auf, eilte hinzu und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Hans-Joachim, der Jüngere, sieht es heute noch vor sich, wie seine Mutter aus dem Mund blutet. Die Verhaftung ging sehr schnell. Der Vater war kaum in der Wohnung, wurde ihm die Festnahme verkündet. Die Tasche mit der Thermoskanne darin, die er bei sich hatte, wurde kurz besichtigt und an die Ehefrau weitergegeben. Dann schoben die Männer Bernhard Rosenstein zur Tür hinaus. Eine Durchsuchung der Wohnung, eine Befragung fand nicht statt. Die Gestapo war sich ihrer Sache offensichtlich so sicher, dass Beweise oder Aussagen nicht weiter interessierten. Frau und Kinder blieben wie gelähmt zurück.
Warum wurde Bernhard Rosenstein verhaftet, als sogenannter Schutzhäftling der Gestapo in das Polizeigefängnis Fuhlsbüttel gebracht, ohne Gerichtsverfahren auf die Liquidationsliste gesetzt und im Arrestbunker des Konzentrationslagers Neuengamme ermordet? Was war so gefährlich an ihm, dass er "unbedingt zu beseitigen" war?
Nach Kriegsende bemühten sich die Angehörigen immer wieder, eine Antwort auf diese Fragen zu finden, vergebens. Rosenstein hatte keiner politischen Organisation angehört, in Kreisen des Widerstands war er unbekannt, das sonst sehr gut informierte Komitee ehemaliger politischer Gefangener hatte noch nie von ihm gehört. So bleibt die Vermutung, auf die auch Rosensteins Arbeitgeber Pank gekommen war, dass er Opfer des Antisemitismus in der Hamburger Gestapo geworden war. Zu den Urhebern der Liquidationsliste zählte unter anderen der Kriminalsekretärs Henry Helms (*1902). ein hochaktiver Mitarbeiter des Sachgebiets IVA1 "Kommunismus" und wie besessen von der Jagd auf alles, was nach Gegnerschaft zum NS-Regime aussah. Mehrfach bezeugt ist darüber hinaus sein verbissener Judenhass. Helms war es, der die Verhaftung und Ermordung der politisch völlig harmlosen "Halbjüdin" Senta Dohme (siehe dort) und des "Halbjuden" Heinrich Bachert (siehe dort) zu verantworten hat. Damit überschritt er zwar die Kompetenzen seines Sachgebietes, aber er fand offensichtlich Zustimmung bei den Vorgesetzten. Sahen sie in überlebenden Juden oder auch nur "Halbjuden" wirklich eine unbedingt zu beseitigende Gefahr oder nutzten sie einfach die Gelegenheit zu einem persönlichen Beitrag zur "Endlösung"?
Bernhard Rosensteins Hinterbliebene, Eltern wie Ehefrau und vor allem die beiden Kinder, hatten es nach seinem Tode über Jahre hinweg, auch noch nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland, sehr schwer, finanziell, psychisch, gesundheitlich, im gesellschaftlichen Fortkommen. Ingeborg Rosenstein versetzte in ihrer materiellen Not Hausrat, der ihr entbehrlich schien, sie litt unter Depressionen und Kopfschmerzen. Die Kinder waren unterernährt, wurden lungenkrank und mehrmals verschickt. Wie sie heute freimütig sagen, war die Schulzeit Angst und Qual. Sie waren Versager, in den Augen der Lehrer wie in ihrer Selbsteinschätzung. Sie waren die Außenseiter, auch wegen des Familiennamens und ihrer Herkunft, selbst nach 1945.
Hans-Jürgen, der Ältere, zu Ostern 1943 eingeschult, hatte von August 1943 bis August 1945, wie die anderen Hamburger Schüler auch, keinen offiziellen Unterricht, war aber wegen seiner jüdischen Vorfahren sowohl vom Privatunterricht als auch von der Kinderlandverschickung ausgeschlossen. Im März 1952 wurde er mit dem Abgangszeugnis aus der 7. Klasse entlassen. Er wurde wie der Vater Kraftfahrer und brachte es schließlich zum kaufmännischen Angestellten.
Der Jüngere, Hans-Joachim, heuerte nach seiner Entlassung aus der Schule mit 15 Jahren im Januar 1955 sofort als Decksjunge an, durchlitt Prügel und Schikanen, schlug sich dann an Land als Beifahrer, Tankwartlehrling, Hilfsarbeiter durch, kehrte zur Seefahrt zurück und rackerte sich nach oben bis zum Touristikmanager auf Kreuzfahrtschiffen. Schließlich ging er endgültig von Bord, machte sich selbstständig und eröffnete einen Taxi-Betrieb in Hamburg.
Stand: November 2017
© Johannes Grossmann
Quellen: StaH 351/11 (AfW)_2210 Bernhard Max Emil Rosenstein; _39800 Ingeborg Rosenstein; _35863 Erbengemeinschaft Rosenstein; _508887 Hans-Jürgen Rosenstein; _51372 Hans-Joachim Rosenstein; StaH 132-11_2848; StaH 213-11_2122/35; Standesämter Hamburg: Sta 20, Nr. 2342/1910 (Geburtsurkunde Bernhard R.); Sta 30, Nr. 216/1914 (Geburtsurkunde Ingeborg de Groot); Sta 20b, Nr.50/1936 (Heiratsurkunde); Sta Neuengamme, Nr. 35/8.6.1945 (Sterbeurkunde Bernhard R.); StaH 522-1, 992b Kultussteuerkarte der Deutsch-Israelitischen Gemeinde, Nr. 8897 Max Rosenstein; StaH 741-4, Straßenkartei der Hausmeldekartei, K 6163, K 2444; Adressbücher Hamburg 1925-1943;
Gespräche und E-Mail Korrespondenz mit Hans-Jürgen Rosenstein und Hans-Joachim Rosenstein, beide Hamburg, zwischen 11.4. und 20.11.2017; E-Mail von Mark Zaurov, Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser, Hamburg, 16.6.2017; E-Mail von Sebastian Rosenau, Handelskammer Hamburg, 17.8.2017; E-Mail von Christian Suhr, Vomag- und Kraftfahrzeugarchiv, Reichenbach, 20.8.2017; E-Mail von Angelika Nawroth, Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Potsdam, 6.11.2017; E-Mail von Martin Spruijt, St-Pauli-Archiv, Hamburg, 7.11.2017; Herbert Diercks, Gedenkbuch "Kola-Fu"/Für die Opfer aus dem Konzentrationslager, Gestapo-Gefängnis und KZ-Außenlager Fuhlsbüttel, (Hrsg.) Gedenkstätte Neuengamme, Hamburg 1987; ders., Dokumentation Stadthaus. Die Hamburger Polizei im Nationalsozialismus, Hrsg. KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Hamburg 2012; Ursel Hochmuth/Gertrud Meyer, Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933–1945, München 1980; KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Totenbuch, Hrsg. Freundeskreis e.V., Hamburg 1967; Johannes Grossmann, Die letzten Toten von Neuengamme, Hamburger Abendblatt Magazin, Nr. 14/2015, www.stolpersteine-hamburg.de/ Dokumentationen; Beate Meyer, "Jüdische Mischlinge", Rassenpolitik und Verfolgungserfahrung 1933–1945, Hamburg 1999; dies., (zu Helms), "Goldfasane" und "Narzissen". Die NSDAP im ehemals "roten" Stadtteil Hamburg-Eimsbüttel, Hamburg 2002, S. 105–198; Curiohaus-Prozess, Verhandelt vor dem britischen Militärgericht in der Zeit vom 18. März bis zum 3.Mai 1946 gegen die Hauptverantwortlichen des KZ Neuengamme, (Hrsg.) Freundeskreis der Gedenkstätte Neuengamme e.V., Hamburg 1969, drei Bände; StaH 213-11_2694/56, Staatsanwaltschaft/ Landgericht/ Strafsachen gegen Henry Helms und Andere, 23 Bände, besonders 1 bis 5, 8, 9, 18, 21, 23 (Urteil). Siehe auf www.stolpersteine-hamburg.de auch die Biographien der ebenfalls im April 1945 in Neuengamme ermordeten Personen Heinrich Bachert, Erna Behling, Senta Dohme, Gerhard Dohme, Erika Etter, Ernst Fiering, Maria Fiering, Helene Heyckendorf, Rudolf Ladewig sen., Rudolf Ladewig jr., Annemarie Ladewig, Kurt Ledien, Hanne Mertens, Margarethe Mrosek, Franz Reetz, Elisabeth Rosenkranz, Heinrich Schröder, Margit Zinke, Paul Zinke.